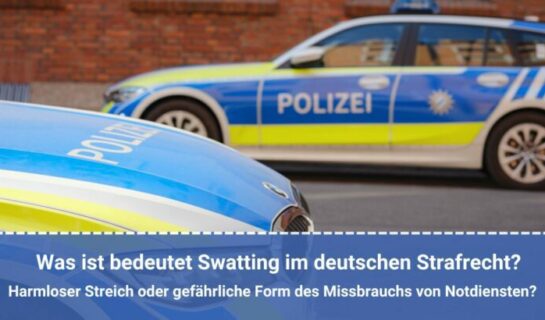Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Kammergericht kippt Urteil: Schwerwiegende Mängel bei Beweiswürdigung im Berliner Rezeptbetrugsfall um HIV-Medikamente
- Berliner Apotheker wegen gewerbsmäßigen Rezeptbetrugs mit HIV-Medikamenten angeklagt
- Urteile der Vorinstanzen: Verurteilung wegen Betrugs trotz Berufung des Apothekers
- Revision vor dem Kammergericht: Zweifel an der Beweiswürdigung des Landgerichts
- Kammergericht hebt Urteil auf: Erfolg für den Apotheker wegen Rechtsfehlern
- Gravierende Mängel in der Beweiswürdigung: Urteil des Landgerichts nicht tragfähig
- Konsequenzen der Entscheidung: Umfang der Aufhebung und Zurückverweisung zur Neuverhandlung
- Ausblick auf das neue Verfahren: Hinweise des Kammergerichts zur Beweislage
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet „Beweiswürdigung“ im juristischen Kontext?
- Welche Rolle spielt die Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen bei der Beweiswürdigung?
- Was ist eine „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“ und welche besonderen Anforderungen gelten in solchen Fällen?
- Was bedeutet „Revision“ und welche Möglichkeiten hat ein Gericht im Revisionsverfahren?
- Welche Bedeutung hat § 267 StPO für die Urteilsfindung und die Nachvollziehbarkeit von Urteilen?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 2 121 Ss 133/21 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: KG Berlin
- Datum: 30.03.2022
- Aktenzeichen: (2) 121 Ss 133/21 (34/21)
- Verfahrensart: Revision im Strafverfahren
- Rechtsbereiche: Strafrecht (Betrug)
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Ein Apothekeninhaber wurde beschuldigt, Rezepte für teure Medikamente von einer Zeugin angekauft und diese bei der Krankenkasse abgerechnet zu haben, ohne die Medikamente tatsächlich an die Zeugin auszugeben. Er wurde in zwei Instanzen wegen Betrugs verurteilt.
- Kern des Rechtsstreits: Zentral war die Frage, ob das Gericht die Aussage einer wichtigen Zeugin korrekt bewertet und die Gründe für seine Entscheidung ausreichend im Urteil dargelegt hat. Das Revisionsgericht prüfte, ob dabei Rechtsfehler gemacht wurden.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Kammergericht hat das Urteil des Landgerichts, mit dem der Angeklagte verurteilt wurde, aufgehoben. Der Fall wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
- Begründung: Das Gericht begründete dies mit erheblichen Mängeln in der richterlichen Bewertung der Beweise durch das Landgericht. Insbesondere sei die Würdigung der Zeugenaussage unverständlich, widersprüchlich und die Darstellung im Urteil unzureichend gewesen.
- Folgen: Die Folge ist, dass der Fall von einer anderen Strafkammer des Landgerichts neu verhandelt werden muss. Diese muss die Beweise, insbesondere die Zeugenaussage, unter Berücksichtigung der vom Kammergericht aufgezeigten Fehler neu bewerten.
Der Fall vor Gericht
Kammergericht kippt Urteil: Schwerwiegende Mängel bei Beweiswürdigung im Berliner Rezeptbetrugsfall um HIV-Medikamente
Das Kammergericht Berlin hat ein Urteil des Landgerichts Berlin aufgehoben, mit dem ein Apotheker wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Der Grund für die Aufhebung liegt in gravierenden Mängeln bei der Beweiswürdigung durch das Landgericht, insbesondere bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer zentralen Belastungszeugin.

Die Sache muss nun vor einer anderen Kammer des Landgerichts neu verhandelt werden. Dieser Beschluss vom 30. März 2022 (Az.: (2) 121 Ss 133/21 (34/21)) beleuchtet die hohen Anforderungen an die richterliche Überzeugungsbildung und deren nachvollziehbare Darstellung im Urteil gemäß § 267 der Strafprozessordnung (StPO).
Berliner Apotheker wegen gewerbsmäßigen Rezeptbetrugs mit HIV-Medikamenten angeklagt
Im Zentrum des Verfahrens stand der Inhaber zweier Berliner Apotheken. Die Anklage warf ihm vor, zwischen Februar 2011 und März 2012 systematisch ärztliche Verordnungen (Rezepte) über hochpreisige HIV-Medikamente von einer betäubungsmittelabhängigen Zeugin angekauft zu haben. Diese Rezepte soll ein Arzt namens Dr. W. ausgestellt haben. Laut Anklage bestand die Absprache darin, dass der Apotheker die Rezepte für 100 bis 250 Euro pro Stück erwarb. Anschließend habe er diese Rezepte bei der zuständigen gesetzlichen Krankenkasse zur Abrechnung eingereicht, ohne die darauf verordneten Medikamente tatsächlich an die Zeugin auszuhändigen. Durch dieses Vorgehen soll der Krankenkasse ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden sein, da sie für Medikamente zahlte, die nie an die Patientin abgegeben wurden. Der Vorwurf lautete auf gewerbsmäßigen Betrug, da der Apotheker sich durch die wiederholte Tatbegehung eine Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang verschaffen wollte.
Urteile der Vorinstanzen: Verurteilung wegen Betrugs trotz Berufung des Apothekers
Das Amtsgericht Tiergarten sah die Vorwürfe in erster Instanz als erwiesen an und verurteilte den Apotheker am 1. Februar 2019 wegen Betruges in 13 Fällen. Es verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zusätzlich ordnete das Gericht die Einziehung des Wertes des Erlangten in Höhe von knapp 27.000 Euro an. Dies entspricht dem Betrag, den der Apotheker durch die Einreichung der Rezepte bei der Krankenkasse erhalten haben soll.
Gegen dieses Urteil legte der Apotheker Berufung ein. Das Landgericht Berlin verhandelte den Fall erneut und fällte am 13. Juli 2021 ein geändertes Urteil. Es verurteilte den Apotheker nunmehr wegen „elffachen Betruges“ zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Aufgrund einer festgestellten rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung galt ein Monat der Strafe bereits als vollstreckt. Auch die Summe der Einziehung des Wertes des Erlangten wurde auf rund 23.570 Euro reduziert. Interessanterweise stellten die schriftlichen Urteilsgründe des Landgerichts fest, dass der Apotheker in zwei weiteren angeklagten Fällen freizusprechen sei. Dieser Freispruch fand jedoch aufgrund eines „Redaktionsversehens“, wie es das Kammergericht später formulierte, keinen Eingang in den Urteilstenor, also die eigentliche Entscheidungsformel.
Revision vor dem Kammergericht: Zweifel an der Beweiswürdigung des Landgerichts
Mit dem Berufungsurteil gab sich der Apotheker nicht zufrieden und legte Revision beim Kammergericht ein, der nächsten und letzten Instanz in diesem Fall. Seine Verteidigung rügte sowohl Verletzungen materiellen Rechts (also Fehler bei der Feststellung des Sachverhalts oder dessen rechtlicher Bewertung) als auch formelle Mängel im Verfahren (Verfahrensrügen). Insbesondere wurde die fehlerhafte Ablehnung von zwei Hilfsbeweisanträgen durch das Landgericht beanstandet. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, als Vertreterin der Anklage im Revisionsverfahren, unterstützte die Revision teilweise und schloss sich der Verfahrensrüge bezüglich eines der Hilfsbeweisanträge an. Im Kern ging es bei der Revision um die Frage, ob die Beweiswürdigung des Landgerichts, die maßgeblich auf der Aussage der Hauptbelastungszeugin beruhte, den rechtlichen Anforderungen standhält.
Kammergericht hebt Urteil auf: Erfolg für den Apotheker wegen Rechtsfehlern
Das Kammergericht Berlin gab der Revision des Apothekers statt. Es entschied, dass bereits die Sachrüge, also der Einwand materieller Rechtsfehler, Erfolg hat. Die Beweiswürdigung des Landgerichts Berlin wurde als nicht tragfähig bewertet und somit die Grundlage für die Verurteilung als fehlerhaft angesehen. Das Kammergericht hob das Urteil des Landgerichts vom 13. Juli 2021 mitsamt den zugrundeliegenden Feststellungen auf, soweit der Apotheker verurteilt worden war. Eine Prüfung der zusätzlich erhobenen Verfahrensrügen war damit nicht mehr notwendig. Die Sache wurde zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts Berlin zurückverwiesen. Auch über die Kosten des Revisionsverfahrens muss diese neue Kammer entscheiden.
Gravierende Mängel in der Beweiswürdigung: Urteil des Landgerichts nicht tragfähig
Das Kammergericht begründete seine Entscheidung ausführlich mit den grundlegenden Mängeln in der Beweiswürdigung des Landgerichts. Zwar prüft das Revisionsgericht die Beweiswürdigung der Tatsacheninstanz nur auf Rechtsfehler – also ob sie widersprüchlich, unklar, lückenhaft ist, gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt oder relevante Umstände übergeht. Genau solche Fehler sah das Kammergericht hier jedoch als gegeben an.
Ein zentraler Kritikpunkt betraf die Darstellung der Beweisaufnahme im Urteil, die den Anforderungen des § 267 Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO) nicht genügte. Das Landgericht hatte die Aussage der zentralen Belastungszeugin M., die im Laufe des Verfahrens unterschiedliche Rollen innehatte, auf neun eng beschriebenen Seiten nahezu wörtlich in direkter Rede wiedergegeben. Dies widerspricht laut Kammergericht fundamental dem Sinn einer Beweiswürdigung. Diese soll die für die Überzeugungsbildung des Gerichts maßgeblichen Aspekte knapp und präzise herausarbeiten und analysieren, warum das Gericht einer Aussage glaubt oder nicht. Eine uferlose Dokumentation der Aussage ohne klare Analyse mache eine revisionsrechtliche Überprüfung der richterlichen Bewertung unmöglich. Das Urteil sei nicht dazu da, die Akteninhalte ungefiltert wiederzugeben.
Unklare und widersprüchliche Argumentation des Landgerichts
Neben den Darstellungsmängeln kritisierte das Kammergericht auch die inhaltliche Würdigung der Zeugenaussage als teilweise schwer nachvollziehbar, unverständlich und in sich widersprüchlich. So fanden sich unter Überschriften wie „Realkennzeichen“ (Merkmale, die auf einen realen Erlebnishintergrund einer Aussage hindeuten) Ausführungen, die damit nichts zu tun hatten, etwa zur Detailarmut der Aussage oder zu Widersprüchen bezüglich des Drogenkonsums der Zeugin. Verweise auf andere Urteilsteile waren oft ungenau. Das Landgericht begründete seine Überzeugung teilweise mit Formulierungen wie „unwahrscheinlich“ oder traf Mutmaßungen (z.B. „vielleicht wegen Urlaubs“), was keine solide Basis für eine richterliche Überzeugung darstellt.
Auch ein verfahrensrechtliches Missverständnis wurde bemängelt: Die Formulierung, die Zeugin habe sich im Verfahren gegen sie „erst als Angeklagte und später als Zeugin“ eingelassen, sei in dieser Form innerhalb derselben Instanz rechtlich nicht nachvollziehbar. Zudem sei die Feststellung, die Zeugin sei bei Vernehmungen in der Lage gewesen, „auf Fragen und Nachfragen zu antworten“, ohne konkrete Beispiele wertlos für die Glaubhaftigkeitsprüfung. Unklar blieb auch die Rolle und Wahrnehmungsfähigkeit weiterer im Urteil erwähnter Zeugen und Personen.
Fehlende Aufklärung zum Parallelverfahren der Hauptzeugin
Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt war die lückenhafte Darstellung des Strafverfahrens, das gegen die Hauptzeugin M. selbst geführt wurde. Das Landgericht hatte zwar erwähnt, dass die Zeugin wegen ähnlicher Taten mit einem anderen Apotheker verurteilt und das hiesige Verfahren gegen sie gemäß § 154 Absatz 1 StPO (Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit bei zu erwartender Strafe aus anderem Verfahren) eingestellt wurde. Für eine umfassende Bewertung ihrer Glaubhaftigkeit und ihrer Aussagemotivation wäre jedoch eine detailliertere Darstellung dieses Parallelverfahrens notwendig gewesen: Worum ging es genau? Welcher Tatzeitraum war betroffen? Gab es Ähnlichkeiten im Vorgehen? Wie hoch war die Strafe? Diese Informationen fehlten, obwohl sie relevant für die Frage sein könnten, ob die Zeugin ein Interesse daran hatte, den angeklagten Apotheker zu belasten, um möglicherweise Vorteile im eigenen Verfahren zu erlangen.
Widersprüchlicher Umgang mit entlastenden Beweisanträgen
Besonders widersprüchlich erschien dem Kammergericht der Umgang des Landgerichts mit einem Hilfsbeweisantrag der Verteidigung. Dieser Antrag zielte darauf ab zu beweisen, dass der angeklagte Apotheker an drei spezifischen Tagen, an denen laut Anklage Rezepte angekauft worden sein sollen (9. Mai 2011, 5. September 2011, 10. April 2012), gar nicht in Berlin war. Das Landgericht unterstellte diese Abwesenheit als wahr. Daraus schlussfolgerte es jedoch nicht etwa, dass die Taten an diesen Tagen nicht stattgefunden haben könnten, sondern drehte die Argumentation um: Die Zeugin M. müsse sich bezüglich dieser drei Tage geirrt haben und die Rezepte an diesen Daten (entgegen ihrer sonstigen Aussage) tatsächlich gegen Medikamente eingelöst haben. Das Landgericht spekulierte über mögliche Erinnerungsfehler oder unterstellte der Zeugin sogar bewusst falsche Angaben zu diesen Daten, um die Einstellung ihres eigenen Verfahrens nach § 154 StPO nicht zu gefährden.
Gleichzeitig erklärte das Landgericht aber, es sei überzeugt, dass der Zeugin bei den übrigen elf Taten kein Irrtum unterlaufen sei. Die Begründung für diesen selektiven Irrtum bzw. die angebliche Falschaussage nur für die drei Alibi-Tage – nämlich dass die Zeugin an diesen Tagen vielleicht auch günstigere „Norvir“-Rezepte eingelöst habe, deren Verkauf sich nicht gelohnt hätte – befand das Kammergericht als unverständlich und widersprüchlich. Denn laut den eigenen Feststellungen des Landgerichts hatte die Zeugin an genau diesen Tagen auch Rezepte für hochpreisige Medikamente eingereicht, deren Ankauf sich für den Apotheker sehr wohl gelohnt hätte. Einen nachvollziehbaren Grund, warum die Zeugin nur bezüglich dieser drei Tage irren oder lügen, ansonsten aber zuverlässig sein sollte, legte das Landgericht somit nicht dar. Diese Widersprüche in der Beweiswürdigung waren für das Kammergericht nicht hinnehmbar.
Konsequenzen der Entscheidung: Umfang der Aufhebung und Zurückverweisung zur Neuverhandlung
Die festgestellten Rechtsfehler führten zur vollständigen Aufhebung des Urteils, soweit der Apotheker verurteilt worden war. Eine Ausnahme machte das Kammergericht für die Tatvorwürfe zu den Rezepten vom 5. September 2011 und 10. April 2012. Hier ging das Kammergericht davon aus, dass das Landgericht – wie in den Urteilsgründen ausgeführt – eigentlich einen Freispruch beabsichtigt hatte, dieser aber nur durch ein „Redaktionsversehen“ nicht im Tenor landete. Diese beiden Vorwürfe sind daher nicht mehr Gegenstand des neuen Verfahrens. Für die übrigen elf angeklagten Fälle muss nun eine neue Hauptverhandlung vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts Berlin stattfinden. Diese Kammer muss den Sachverhalt erneut aufklären, alle Beweise würdigen und eine neue Entscheidung treffen.
Ausblick auf das neue Verfahren: Hinweise des Kammergerichts zur Beweislage
Abschließend gab das Kammergericht der neuen Strafkammer noch einen Hinweis für die kommende Verhandlung mit auf den Weg. Entgegen der Auffassung der Verteidigung handele es sich bei dem Fall nicht um eine reine „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“. Eine solche liegt nur vor, wenn ein Angeklagter die Tat bestreitet und ausschließlich die Aussage eines einzigen Zeugen ohne weitere objektive Beweise gegen ihn steht. Hier hatte sich der Apotheker jedoch nicht zur Sache eingelassen, also geschwiegen. Zudem werden die Angaben der Hauptzeugin M. nach Ansicht des Kammergerichts durchaus durch weitere Beweismittel gestützt. Dazu zählen insbesondere die zahlreichen Urkunden (die ärztlichen Verordnungen selbst, die auf weit mehr Medikamente lauteten als benötigt und von verschiedenen Ärzten stammten, sowie deren Einreichung in den Apotheken des Angeklagten) und die Aussagen weiterer Zeugen. Genannt wurde beispielsweise ein Mitarbeiter R., der bekundet haben soll, dass HIV-Kunden primär vom Angeklagten selbst bedient wurden, oder eine Zeugin K., die Angaben zur Kameraüberwachung in der Apotheke machen konnte. Diese gesamte Beweislage muss die neue Kammer des Landgerichts in ihre erneute Beweiswürdigung einbeziehen und umfassend bewerten. Der Fall bleibt somit offen und muss neu aufgerollt werden.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil demonstriert die hohen Anforderungen an die richterliche Beweiswürdigung im Strafprozess, insbesondere bei der Beurteilung von Zeugenaussagen. Zentrale Erkenntnis ist, dass eine bloße Wiedergabe von Beweismitteln ohne nachvollziehbare Analyse und widerspruchsfreie Würdigung zur Aufhebung eines Urteils führen kann. Die Quintessenz liegt in der Verpflichtung der Gerichte, ihre Überzeugungsbildung transparent und logisch konsistent darzustellen, besonders wenn sie selektiv Teile einer Zeugenaussage als glaubhaft und andere als unglaubhaft einstufen. Dies verdeutlicht, wie essentiell eine sorgfältige, in sich stimmige Beweisanalyse für die Rechtssicherheit ist und dass selbst bei schwerwiegenden Betrugsvorwürfen prozessuale Sorgfalt nicht vernachlässigt werden darf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet „Beweiswürdigung“ im juristischen Kontext?
Stellen Sie sich vor, in einem Gerichtsverfahren liegen verschiedene Informationen vor: Ein Zeuge sagt etwas aus, es gibt ein Dokument, das scheinbar das Gegenteil beweist, und vielleicht noch die Einschätzung eines Sachverständigen. Die Beweiswürdigung ist der wichtige Prozess, bei dem das Gericht – also der Richter oder die Richterin – all diese vorgelegten Beweismittel genau prüft und bewertet.
Das Ziel der Beweiswürdigung ist es, sich eine Überzeugung darüber zu bilden, was wirklich passiert ist. Hat sich der behauptete Sachverhalt ereignet oder nicht? Dafür schaut das Gericht nicht nur, ob Beweise da sind, sondern vor allem auch, wie überzeugend sie sind.
Bei dieser Prüfung geht es darum:
- Die Glaubwürdigkeit von Zeugen einzuschätzen: Widersprechen sich Aussagen? Wirken sie ehrlich und nachvollziehbar? Hat der Zeuge etwas wirklich selbst gesehen oder nur gehört?
- Die Aussagekraft von Dokumenten zu beurteilen: Ist ein Vertrag echt? Was genau steht in einem Schreiben? Passt der Inhalt zu den anderen Beweisen?
- Die Plausibilität von Indizien zu prüfen: Ein Indiz ist ein Anzeichen, das nicht direkt beweist, aber auf etwas hindeuten kann. Mehrere Indizien zusammen können sehr überzeugend sein. Das Gericht fragt sich: Ergibt die Kombination aller Hinweise einen logischen Sinn?
Das Gesetz sagt dazu, dass der Richter nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung entscheidet, ob eine Tatsache für wahr oder nicht für wahr erachtet wird. Das bedeutet, der Richter ist nicht an starre Regeln gebunden, wie viel welches Beweismittel wert ist, sondern muss alle Beweise im Zusammenhang betrachten und seine Entscheidung überzeugend begründen.
Für Sie als Beteiligten bedeutet das: Das Gericht nimmt nicht einfach einen Beweis an, sondern wägt sorgfältig ab, welche Informationen glaubwürdig und relevant sind, um den Sachverhalt zu klären. Dieser Prozess der Beweiswürdigung ist entscheidend für das spätere Urteil.
Welche Rolle spielt die Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen bei der Beweiswürdigung?
Die Aussage eines Zeugen ist oft ein sehr wichtiges Beweismittel in einem Gerichtsverfahren. Sie kann entscheidend dafür sein, ob das Gericht eine bestimmte Tatsache als erwiesen ansieht oder nicht. Hier kommt die Glaubwürdigkeit ins Spiel.
Für das Gericht ist es von zentraler Bedeutung, wie glaubwürdig die Person ist, die aussagt, und wie glaubhaft ihre Aussage selbst ist. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Mosaik: Die Zeugenaussage ist nur ein Stein, aber ihre Qualität – also ihre Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit – bestimmt, wie gut sie ins Gesamtbild passt und wie viel Gewicht ihr gegeben wird.
Das Gericht muss die Aussage eines Zeugen sehr sorgfältig prüfen. Dabei schaut es auf verschiedene Dinge:
Wie beurteilt das Gericht die Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit?
Richterinnen und Richter sind gesetzlich verpflichtet, Beweise frei zu würdigen. Das bedeutet, sie entscheiden nach ihrer persönlichen Überzeugung, ob eine Aussage wahr ist, basierend auf dem Gesamtergebnis der Verhandlung. Es gibt keine starren Regeln, aber das Gericht orientiert sich an bestimmten Kriterien, um die Aussage zu bewerten:
- Innere Stimmigkeit der Aussage: Macht die Geschichte, die der Zeuge erzählt, in sich Sinn? Gibt es Widersprüche innerhalb der Aussage? Ändert der Zeuge seine Darstellung?
- Übereinstimmung mit anderen Beweismitteln: Passt die Zeugenaussage zu anderen Beweisen im Fall, zum Beispiel zu Dokumenten, Gutachten oder den Aussagen anderer Zeugen? Wenn alle anderen Beweise in eine andere Richtung weisen, wird die Zeugenaussage kritischer betrachtet.
- Detailgrad und Logik: Kann der Zeuge sich an wichtige Details erinnern? Wirkt die Aussage aus sich heraus schlüssig und nachvollziehbar?
- Verhalten des Zeugen vor Gericht: Wie tritt der Zeuge auf? Ist er bereit, Fragen zu beantworten? Wirkt er ehrlich und unbefangen, oder eher ausweichend oder unsicher (wobei Nervosität allein nicht gegen die Glaubwürdigkeit spricht)? Das Gericht gewinnt einen persönlichen Eindruck.
- Motivation des Zeugen: Hat der Zeuge einen Grund, die Unwahrheit zu sagen (z.B. persönliche Vorteile, eine Beziehung zu einer Partei)?
Das Gericht betrachtet all diese Punkte und bildet sich auf dieser Grundlage ein Urteil über die Verlässlichkeit der Aussage. Es geht also nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch, wie und von wem es gesagt wird.
Welche Konsequenzen hat es, wenn das Gericht zweifelt?
Zieht das Gericht die Glaubwürdigkeit des Zeugen oder die Glaubhaftigkeit seiner Aussage in Zweifel, hat das direkte Auswirkungen auf die Beweiswürdigung.
- Die Aussage erhält weniger Gewicht im Gesamtbild der Beweise.
- Im schlimmsten Fall, wenn die Zweifel so groß sind, dass das Gericht der Aussage überhaupt keinen Glauben schenken kann, wird sie bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt.
Wenn eine bestimmte Tatsache nur durch die Aussage dieses einen Zeugen bewiesen werden sollte und das Gericht dieser Aussage wegen fehlender Glaubwürdigkeit keinen Glauben schenkt, kann das dazu führen, dass die erforderliche Tatsache als nicht bewiesen gilt. Das Gericht muss in seinem Urteil genau erklären, warum es eine Zeugenaussage für glaubwürdig oder eben nicht für glaubwürdig hält.
Was ist eine „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“ und welche besonderen Anforderungen gelten in solchen Fällen?
Stellen Sie sich eine Situation vor Gericht vor, bei der die Aussage einer Person der Aussage einer anderen Person direkt widerspricht. Es gibt keine weiteren eindeutigen Beweise wie Dokumente, Fotos, Videos oder unabhängige Zeugen, die eine der beiden Darstellungen eindeutig bestätigen oder widerlegen. Genau das ist eine „Aussage-gegen-Aussage-Konstellation“. Sie liegt typischerweise vor, wenn beispielsweise das angebliche Opfer einer Tat und der Beschuldigte völlig unterschiedliche Versionen des Geschehens schildern und keine weiteren Beweismittel zur Verfügung stehen.
Besondere Sorgfalt bei der Beweiswürdigung
In solchen Fällen steht das Gericht vor einer besonderen Herausforderung. Es muss entscheiden, welche der widersprüchlichen Aussagen glaubwürdiger ist. Dies erfordert eine äußerst sorgfältige und umfassende Prüfung beider Aussagen sowie der Personen, die sie tätigen.
Das Gericht betrachtet dabei verschiedene Aspekte, um die Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Dazu gehören unter anderem:
- Konstanz der Aussage: Bleibt die Person bei ihrer Darstellung oder ändert sie wichtige Details?
- Detailreichtum: Enthält die Aussage lebendige, nachvollziehbare Details, die nicht einfach erfunden wirken?
- Übereinstimmung mit bekannten Fakten: Passen Teile der Aussage zu anderen unumstrittenen Gegebenheiten, auch wenn es keine direkten Beweise gibt?
- Motiv für eine Falschaussage: Könnte die Person einen Grund haben, bewusst die Unwahrheit zu sagen?
- Entstehung der Aussage: Wie und wann wurde die Aussage gemacht (z.B. spontan oder nach längerem Überlegen)?
Das Gericht muss alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen und die Aussagen umfassend zu würdigen.
Der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ (in dubio pro reo)
Eine ganz wichtige Regel, die in Deutschland gilt, ist der Grundsatz „in dubio pro reo“. Das bedeutet übersetzt „Im Zweifel für den Angeklagten“.
Gerade in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen spielt dieser Grundsatz eine entscheidende Rolle. Das Gericht muss davon überzeugt sein, dass der Angeklagte die Tat zweifelsfrei begangen hat. Wenn das Gericht nach sorgfältiger Prüfung aller Umstände – einschließlich der widersprüchlichen Aussagen und der Bewertung ihrer Glaubwürdigkeit – nicht die volle Überzeugung gewinnen kann, dass die Anklage zutrifft, dann muss es den Angeklagten freisprechen. Es reicht nicht aus, wenn das Gericht die Aussage der anklagenden Person möglicherweise für wahr hält. Ein Restzweifel führt zur Entlastung des Angeklagten.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Aussage-gegen-Aussage-Fälle sind komplex und erfordern vom Gericht eine besonders gründliche Arbeit bei der Bewertung der Aussagen und der vorhandenen (oft wenigen) Beweismittel. Der wichtige Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ sorgt dafür, dass niemand verurteilt wird, wenn das Gericht nicht völlig von seiner Schuld überzeugt ist.
Was bedeutet „Revision“ und welche Möglichkeiten hat ein Gericht im Revisionsverfahren?
Wenn in einem Gerichtsverfahren von „Revision“ die Rede ist, bedeutet dies, dass eine Partei das Urteil eines Gerichts auf eine ganz bestimmte Art überprüfen lassen möchte. Die Revision ist ein Rechtsmittel. Stellen Sie sich das wie eine Möglichkeit vor, nach einem Urteil noch eine höhere Instanz einzuschalten, aber nicht um den gesamten Fall von vorne zu verhandeln.
Der zentrale Punkt bei der Revision ist, dass nicht mehr die Tatsachen des Falles neu bewertet werden. Es geht nicht darum, ob ein Zeuge glaubwürdig war oder ob ein bestimmtes Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. Das Revisionsgericht überprüft ausschließlich, ob das Urteil der vorherigen Instanz auf Rechtsfehlern beruht. Das bedeutet, es wird geprüft, ob das Gericht die Gesetze richtig angewendet oder ob es Verfahrensvorschriften verletzt hat.
Welche Möglichkeiten hat das Revisionsgericht?
Das Gericht, das über die Revision entscheidet (das Revisionsgericht), hat typischerweise folgende Hauptmöglichkeiten:
- Das Urteil wird bestätigt: Findet das Revisionsgericht keine Rechtsfehler im angefochtenen Urteil, erklärt es die Revision für unbegründet. Das bedeutet, das ursprüngliche Urteil bleibt bestehen und ist nun rechtskräftig.
- Das Urteil wird aufgehoben und zurückverwiesen: Stellt das Revisionsgericht fest, dass Rechtsfehler vorliegen, die das Urteil beeinflussen, kann es das Urteil aufheben. Das bedeutet, das Urteil wird kassiert. Meistens schickt das Revisionsgericht den Fall dann an die Vorinstanz (das Gericht, das das Urteil ursprünglich gesprochen hat) zurück, damit dieser Fall unter Beachtung der rechtlichen Sichtweise des Revisionsgerichts neu verhandelt und entschieden wird. Das Gericht, an das zurückverwiesen wurde, muss dabei die Rechtsauffassung des Revisionsgerichts berücksichtigen. Es kann den Fall also nicht einfach so entscheiden, wie es das erste Mal getan hat.
- Das Gericht entscheidet selbst in der Sache: Nur in Ausnahmefällen, wenn der Sachverhalt (die Tatsachen des Falles) bereits vollständig geklärt ist und keine weitere Beweisaufnahme nötig wäre, kann das Revisionsgericht das Urteil aufheben und direkt selbst eine abschließende Entscheidung treffen. Dies ist aber seltener der Fall als die Zurückverweisung.
Wenn Sie also hören, dass in einem Fall Revision eingelegt wurde, bedeutet dies, dass das Urteil des vorherigen Gerichts nun auf Rechtsfehler hin von einem höheren Gericht überprüft wird.
Welche Bedeutung hat § 267 StPO für die Urteilsfindung und die Nachvollziehbarkeit von Urteilen?
Im Strafprozess ist das Urteil des Gerichts die Entscheidung über Schuld oder Unschuld und gegebenenfalls über die Strafe. Damit dieses Urteil nicht nur eine bloße Entscheidung ist, sondern auch verstanden und überprüft werden kann, schreibt das Gesetz in § 267 der Strafprozessordnung (StPO) vor, dass jedes Urteil eine Begründung haben muss.
Stellen Sie sich vor, ein Gericht entscheidet über einen Fall, der Sie betrifft. Für Sie ist es wichtig zu wissen, warum das Gericht zu genau diesem Ergebnis gekommen ist. Hier setzt § 267 StPO an. Die Vorschrift verlangt vom Gericht, dass es in seinem schriftlichen Urteil die wesentlichen Gründe darlegt, die zu seiner Entscheidung geführt haben. Das umfasst:
- Die Feststellungen, welche Tatsachen das Gericht für bewiesen hält (z.B. „Die Tat hat sich so und so ereignet“).
- Die Beweismittel, auf die sich das Gericht bei diesen Feststellungen stützt (z.B. Zeugenaussagen, Dokumente).
- Bei einer Verurteilung die rechtliche Begründung, warum das festgestellte Geschehen eine Straftat darstellt.
- Bei einer Verurteilung auch die Gründe für die Strafzumessung (warum genau diese Strafe verhängt wurde).
Warum ist diese Begründungspflicht so wichtig?
Die Pflicht zur umfassenden Begründung des Urteils dient mehreren zentralen Zwecken im Strafverfahren:
- Nachvollziehbarkeit: Sie ermöglicht es allen Beteiligten – dem Angeklagten, der Staatsanwaltschaft, möglichen Nebenklägern und auch der Öffentlichkeit –, zu verstehen, wie das Gericht gedacht hat und auf welcher Grundlage es seine Entscheidung getroffen hat. Es macht das Urteil „gläsern“.
- Kontrolle: Die Begründung ist die Grundlage dafür, dass das Urteil überprüft werden kann. Wenn eine Partei mit dem Urteil nicht einverstanden ist, kann sie Rechtsmittel wie die Berufung oder Revision einlegen. Das höhere Gericht kann dann anhand der schriftlichen Begründung nachvollziehen, ob das erstinstanzliche Gericht die Beweise richtig gewürdigt und das Recht korrekt angewendet hat. Ohne eine Begründung wäre eine wirksame Überprüfung kaum möglich.
- Fairness und Rechtsstaatlichkeit: Die Begründungspflicht zwingt das Gericht, sich intensiv mit dem Fall und den vorliegenden Beweisen auseinanderzusetzen und seine Schlussfolgerungen logisch und nachvollziehbar zu begründen. Das trägt dazu bei, faire und objektive Entscheidungen sicherzustellen und Willkür zu vermeiden.
Kurz gesagt, § 267 StPO stellt sicher, dass ein strafrechtliches Urteil nicht nur ein Ergebnis verkündet, sondern auch den Weg zu diesem Ergebnis transparent aufzeigt. Das stärkt das Vertrauen in die Justiz und gewährleistet, dass Gerichtsentscheidungen überprüfbar bleiben.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Gewerbsmäßiger Betrug
Gewerbsmäßiger Betrug ist eine besonders schwere Form des Betrugs, bei der der Täter die Tat wiederholt begeht, um sich dauerhaft und in größerem Umfang Einnahmen zu verschaffen. Das Strafgesetzbuch (StGB) nennt diese Regelung in § 263 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1. Hierbei liegt der Fokus nicht nur auf dem einzelnen Betrug, sondern auf der Absicht, durch eine fortlaufende Tätigkeit Profit zu erzielen. Im vorliegenden Fall wird dem Apotheker vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum Rezepte systematisch zu missbrauchen, um Gelder von der Krankenkasse zu erschleichen.
Beispiel: Jemand fälscht mehrfach Rechnungen, um regelmäßig Geld von einer Versicherung zu bekommen. Da er daraus eine dauerhafte Einnahmequelle macht, handelt es sich um gewerbsmäßigen Betrug.
Beweiswürdigung
Die Beweiswürdigung ist der Prozess, bei dem ein Gericht alle im Verfahren vorgelegten Beweismittel (Zeugenaussagen, Dokumente, Sachverständigengutachten usw.) einordnet, bewertet und zueinander in Beziehung setzt. Ziel ist es, auf dieser Grundlage eine Überzeugung über den tatsächlichen Ablauf zu gewinnen, die als Basis für die Entscheidung dient. Die Beweiswürdigung erfolgt frei, das heißt, das Gericht ist bei der Bewertung nicht an starre Regeln gebunden, muss aber seine Schlussfolgerungen in verständlicher und nachvollziehbarer Weise darlegen (§ 267 StPO).
Beispiel: Wenn ein Gericht in einem Diebstahlsprozess Aussagen von Zeugen, Videoaufnahmen und Spuren am Tatort bewertet, prüft es durch Beweiswürdigung, wie glaubwürdig und stimmig die einzelnen Hinweise sind, bevor es einen Schuldspruch ausspricht.
Revision
Die Revision ist ein Rechtsmittel gegen ein Urteil, das vor allem die Überprüfung auf Rechtsfehler ermöglicht. Das Revisionsgericht kontrolliert nicht die Tatsachenfeststellung, sondern prüft, ob das vorgehende Gericht das Recht korrekt angewendet hat und ob das Verfahren ordnungsgemäß war. Kommt es zu relevanten Rechtsfehlern, kann die Revision zur Aufhebung des Urteils und zur Rückverweisung an das Verfahren der Vorinstanz führen (§§ 333 ff. StPO). Im angestrebten Fall des Apothekers ist die Revision erfolgreich gewesen, weil das Kammergericht gravierende Fehler in der Beweiswürdigung festgestellt hat.
Beispiel: Nach einer Verurteilung wegen Betrugs legt der Verurteilte Revision ein, weil das Gericht wichtige Beweise nicht berücksichtigt oder fehlerhafte rechtliche Grundlagen zugrunde gelegt hat.
§ 267 Strafprozessordnung (StPO)
§ 267 StPO regelt die Form und die Begründungspflicht von Urteilen im Strafprozess. Danach muss ein Urteil eine verständliche und nachvollziehbare Begründung enthalten, die die wesentlichen Tatsachenfeststellungen, die Beweiswürdigung und die rechtliche Bewertung umfasst. Dies sichert die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für alle Verfahrensbeteiligten und ermöglicht eine wirkungsvolle Kontrolle durch höhere Gerichte. In dem hier geschilderten Fall bemängelte das Kammergericht, dass das Landgericht seine Beweiswürdigung unzureichend und nicht gut gegliedert im Urteil dargelegt hat, was die gerichtliche Überprüfung erschwerte.
Beispiel: Wenn ein Gericht ein Urteil fällt, muss es erklären, warum es beispielsweise die Zeugen für glaubwürdig hält und wie es daraus die Schuld des Angeklagten ableitet – nur so können Betroffene oder Rechtsmittelgerichte die Entscheidung verstehen und überprüfen.
Hilfsbeweisantrag
Ein Hilfsbeweisantrag ist ein Antrag der Verteidigung oder einer Partei im Strafprozess, der gestellt wird, um im Falle der Ablehnung eines Hauptbeweismittels alternative Beweise zu erheben. Solche Anträge dienen dazu, eine bestimmte Tatsachenbehauptung zu untermauern oder zu widerlegen, falls andere Beweise nicht überzeugen. Im vorliegenden Fall beantragte die Verteidigung einen Hilfsbeweis zu konkreten Abwesenheitszeiten des Apothekers, der aber vom Landgericht abgelehnt wurde. Diese Ablehnung wurde vom Kammergericht als verfahrensrechtlicher Mangel gerügt, da der Antrag wichtige neue Aspekte hätte klären können.
Beispiel: In einem Verfahren beantragt die Verteidigung, Zeugen zu laden, falls das Gericht den Beweis eines Dokuments nicht anerkennt, damit die angegriffene Tatsache möglichst umfassend geprüft wird.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 267 Strafprozessordnung (StPO): Regelt die Anforderungen an die Urteilsverkündung, insbesondere die Begründungspflicht, die eine nachvollziehbare und klare Darstellung der Beweiswürdigung verlangt, damit eine Prüfung durch höhere Instanzen möglich ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Kammergericht beanstandete, dass das Landgericht die Zeugenaussage nur stark wortgetreu und ohne klare Analyse wiedergegeben hat, wodurch die richterliche Überzeugungsbildung nicht transparent und überprüfbar war.
- § 263 Strafgesetzbuch (StGB) – Betrug: Definiert den Tatbestand des Betrugs als rechtswidrige Vermögensverfügung durch Täuschung mit dem Ziel, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Gewerbsmäßigkeit liegt vor, wenn die Taten auf wiederholte Ausführung zur Dauererzielung gerichtet sind. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Anklage gegen den Apotheker basierte auf Vorwürfen zum gewerbsmäßigen Betrug durch systematischen Rezeptankauf und Abrechnung bei gesetzlichen Krankenkassen ohne tatsächliche Medikamentenabgabe.
- § 154 Absatz 1 Strafprozessordnung (StPO): Ermöglicht das Absehen von der Strafverfolgung, wenn die Schuld des Beschuldigten als geringfügig erscheint und eine Strafe aus einem anderen Verfahren zu erwarten ist, um Doppelverfolgung zu vermeiden. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht berücksichtigte, dass die Hauptbelastungszeugin wegen vergleichbarer Taten gegen einen anderen Apotheker verfolgt wurde und ihr Verfahren eingestellt wurde, was jedoch für die Gesamtbewertung unzureichend und unvollständig dargestellt war.
- Beweiswürdigung und Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugen: Grundsatz, dass Richtersprüche auf sorgfältiger, widerspruchsfreier Bewertung aller Beweise beruhen müssen, wobei Aussagen von Zeugen kritisch und verständlich analysiert werden müssen, insbesondere bei widersprüchlichen oder belastenden Aussagen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die vom Landgericht vorgenommene Bewertung der Hauptbelastungszeugin wurde als inkonsequent, widersprüchlich und teilweise spekulativ kritisiert, was die Grundlage der Verurteilung erschütterte.
- Einziehung des Wertes des Erlangten (§§ 73 ff. StGB): Die Möglichkeit, Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt wurden, rückwirkend wieder zu entziehen, um die Bereicherung des Täters und den Schaden auszugleichen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Vorinstanzen ordneten die Einziehung der Erlöse aus den angeblich betrügerisch eingereichten HIV-Medikamentenrezepten an, was jedoch an der Rechtsgrundlage der Tatbegehung anknüpft.
- Verfahrensrügen im Revisionsverfahren: Beziehen sich auf Fehler im Ablauf des Gerichtsverfahrens, wie etwa die fehlerhafte Ablehnung von Beweisanträgen, welche die Wahrheitsfindung beeinträchtigen und somit zu einer Aufhebung des Urteils führen können. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Revision des Apothekers bemängelte u.a. die unzureichende Berücksichtigung von Hilfsbeweisanträgen, was das Kammergericht als weiteren formellen Fehler im Urteilsverfahren wertete und zur Aufhebung des Urteils führte.
Das vorliegende Urteil
KG Berlin – Az.: (2) 121 Ss 133/21 (34/21) – Beschluss vom 30.03.2022
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.