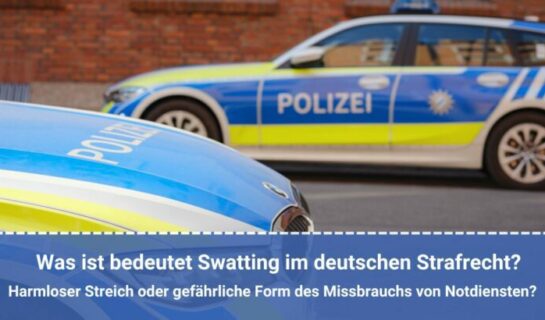Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Versteckspiel hinter dem Strohmann: neues BGH-Urteil nimmt Firmenbestatter ins Visier – Wann der Chef im Hintergrund voll haftet
- Der Fall: ein Profi für den Abgang ins Nichts
- Das erste Urteil: nur ein Helfer im Hintergrund?
- Die Wende in Karlsruhe: Der BGH greift ein
- Faktischer Geschäftsführer: Nicht der Titel zählt, sondern die Macht
- Die Folgen des Urteils: Höheres Risiko für Strippenzieher
- Praktische Tipps: Augen auf in der Unternehmenskrise
- Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema
- Was ist eine Firmenbestattung genau und warum ist sie problematisch?
- Bin ich ein faktischer Geschäftsführer, auch wenn ich nicht im Handelsregister stehe?
- Was ist der Unterschied zwischen Täter und Gehilfe bei Insolvenzstraftaten?
- Welche Aufgaben sind „geschäftsführertypisch“ laut dem neuen BGH-Urteil?
- Wann genau muss ich als Geschäftsführer Insolvenz anmelden?
- Welche Strafen drohen bei Bankrott oder Insolvenzverschleppung?
- Fazit: Substanz schlägt Form – Keine Toleranz für Verschleierung

Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Wer im Hintergrund die tatsächliche Kontrolle über ein Unternehmen hat, haftet jetzt leichter für Insolvenzstraftaten – auch ohne offiziellen Titel als Geschäftsführer.
- Das betrifft primär „Hintermänner“, die Firmenkrisen durch den Einsatz von Strohmännern verschleiern, die formal die Geschäftsführung übernehmen.
- Wer die wichtigen Entscheidungen trifft (z. B. Vermögen entzieht, Insolvenzantrag verhindert), kann strafrechtlich wie ein offizieller Geschäftsführer behandelt werden.
- Das Urteil macht deutlich: Es kommt auf die tatsächliche Macht im Unternehmen an, nicht darauf, wer im Handelsregister steht oder nach außen auftritt.
- Für Betroffene bedeutet das: Vorsicht bei dubiosen Angeboten zur schnellen Übernahme von Firmen in finanziellen Schwierigkeiten. Die Verantwortlichen können härter bestraft werden.
- Unternehmen müssen Insolvenz frühzeitig anmelden (spätestens drei Wochen nach Zahlungsunfähigkeit) und dürfen keine Vermögenswerte heimlich verschieben.
- Das Urteil stärkt die Strafverfolgung gegen Wirtschaftskriminalität und fordert von Geschäftsführern mehr Transparenz sowie verantwortliches Handeln.
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 27. Februar 2025 (Az. 5 StR 287/24)
Versteckspiel hinter dem Strohmann: neues BGH-Urteil nimmt Firmenbestatter ins Visier – Wann der Chef im Hintergrund voll haftet
Ein Unternehmen in Schieflage, die Schulden wachsen, die Gläubiger werden unruhig. Für Geschäftsführer und Gesellschafter beginnt oft ein Albtraum. In dieser Situation klingen Angebote verlockend, die eine schnelle, scheinbar saubere Lösung versprechen: Jemand übernimmt die Firma samt Schulden, kümmert sich um alles Weitere – eine sogenannte „Firmenbestattung“. Doch was wie ein Ausweg aussieht, ist oft der Einstieg in ein Minenfeld strafrechtlicher Risiken.
Besonders für diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27. Februar 2025 (Az. 5 StR 287/24) hat die Spielregeln für solche Hintermänner nun deutlich verschärft. Wer eine Firma faktisch leitet, auch ohne offiziellen Titel, kann nun leichter als Haupttäter für Insolvenzstraftaten zur Verantwortung gezogen werden.
Der Fall: ein Profi für den Abgang ins Nichts
Im Zentrum des BGH-Falls stand ein Mann, nennen wir ihn Herr K., der sich auf ein dubioses Geschäftsmodell spezialisiert hatte. Er war bereits mehrfach wegen Wirtschaftsdelikten vorbestraft und agierte als professioneller Firmenbestatter. Sein Vorgehen war systematisch: Er spürte Unternehmen auf, die kurz vor der Pleite standen oder bereits überschuldet waren. Über eine von ihm beherrschte Ein-Mann-GmbH bulgarischen Rechts kaufte er die Geschäftsanteile dieser maroden Firmen, oft samt Tochtergesellschaften.
Der nächste Schritt folgte prompt: Die bisherigen Geschäftsführer wurden abberufen. An ihre Stelle trat ein von Herrn K. handverlesener Strohmann-Geschäftsführer. Im konkreten Fall war dies ein gewisser Herr V., ein vollzeitbeschäftigter Krankenpflegehelfer ohne jegliche unternehmerische Erfahrung oder Kompetenz. Seine Entlohnung für die Übernahme der formalen Verantwortung fiel bescheiden aus: kleine Geldbeträge, gelegentliche Essenseinladungen. Herr V. war eine Marionette, die Blankounterschriften leistete und sich Herrn K. widerspruchslos unterordnete.
Herr K. hingegen war der eigentliche Strippenzieher. Er traf sämtliche unternehmerischen Entscheidungen im Hintergrund. Er sorgte dafür, dass Herr V. keine relevanten Informationen erhielt und somit faktisch handlungsunfähig war. Nach der Übernahme stellte Herr K. sicher, dass die Geschäftstätigkeit der übernommenen Unternehmen komplett eingestellt wurde. Gleichzeitig wurden verbliebene Vermögenswerte – Forderungen, Bankguthaben, Fahrzeuge – systematisch den Gesellschaften entzogen und landeten letztlich bei Herrn K. oder in seinem Einflussbereich.
Der entscheidende letzte Akt der Firmenbestattung: Die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags wurde bewusst ignoriert. Obwohl die Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet waren, unterblieb der Gang zum Insolvenzgericht. Dies führte in mindestens vier Fällen zur strafbaren Insolvenzverschleppung (§ 15a Insolvenzordnung – InsO). In mindestens drei weiteren Fällen erfüllte das Vorgehen den Tatbestand des vorsätzlichen Bankrotts (§ 283 Strafgesetzbuch – StGB), weil Vermögen beiseitegeschafft wurde.
Das erste Urteil: nur ein Helfer im Hintergrund?
Das Landgericht Leipzig befasste sich als erste Instanz mit dem Fall (Az. 11 KLs 281 Js 35309/18). Mit Urteil vom 7. November 2023 verurteilte es Herrn K. zwar wegen Betruges in fünf Fällen, bei den entscheidenden Insolvenzdelikten – Bankrott und Insolvenzverschleppung – sah es ihn jedoch nur als Gehilfen (§ 27 StGB) des formal bestellten Strohmann-Geschäftsführers V. Die Gesamtstrafe: zwei Jahre und vier Monate Freiheitsstrafe.
Die Begründung des Landgerichts für die Einstufung als bloßer Gehilfe war bemerkenswert: Herr K. erfülle nicht die Kriterien eines faktischen Geschäftsführers. Zwar habe er im Hintergrund die Fäden gezogen, aber er habe eben keine „klassischen“ Geschäftsführertätigkeiten nach außen hin wahrgenommen.
Das Gericht führte an, Herr K. habe weder Personalentscheidungen getroffen (es gab einfach kein Personal mehr), noch Steuerangelegenheiten bearbeitet oder Verträge mit Dritten abgeschlossen. Nach Ansicht des Landgerichts fehlten damit entscheidende Merkmale, die eine Person, die nicht formal bestellt ist, dennoch als faktischen Leiter und damit als Täter qualifizieren könnten. Das Gericht legte hier einen recht starren Kriterienkatalog an.
Die Wende in Karlsruhe: Der BGH greift ein
Mit dieser Einschätzung gab sich die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden. Sie legte Revision zum Bundesgerichtshof ein – ein Rechtsmittel, das Urteile auf Rechtsfehler überprüft. Ihr Ziel: Herr K. sollte nicht nur als Helfer, sondern als eigentlicher Täter der Insolvenzdelikte verurteilt werden. Und die Staatsanwaltschaft bekam Recht.
Der 5. Strafsenat des BGH kassierte das Urteil des Landgerichts Leipzig in Bezug auf die Insolvenzdelikte und verwies die Sache zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Die Begründung der Karlsruher Richter hat es in sich und setzt neue Maßstäbe für die Beurteilung solcher Fälle. Sie ist so grundlegend, dass der BGH sie als Leitsatzentscheidung veröffentlichte – ein Signal für ihre herausragende Bedeutung über den Einzelfall hinaus.
Der BGH kritisierte die Vorgehensweise des Landgerichts scharf. Die Methode, einen starren Katalog von Merkmalen schematisch abzuarbeiten, um die Frage der faktischen Geschäftsführung zu klären, sei schon im Ansatz verfehlt und unzulässig. Man könne die Prüfung eines gesetzlichen Tatbestandsmerkmals nicht durch das Abhaken einer Checkliste ersetzen.
Faktischer Geschäftsführer: Nicht der Titel zählt, sondern die Macht
Was bedeutet „faktischer Geschäftsführer“ überhaupt? Im deutschen Strafrecht gibt es bestimmte Delikte, insbesondere im Wirtschaftsbereich, die nur von Personen mit einer bestimmten Funktion begangen werden können. Man nennt sie Sonderdelikte. Bankrott (§ 283 StGB) und Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO) gehören dazu. Grundsätzlich kann nur der formale Geschäftsführer einer GmbH oder der Vorstand einer AG Täter sein.
Doch was ist, wenn jemand anderes die tatsächliche Kontrolle ausübt? Hier kommt § 14 Absatz 1 Nummer 1 StGB ins Spiel. Diese Norm besagt, dass Strafgesetze, die eine besondere Eigenschaft voraussetzen (wie die Geschäftsführereigenschaft), auch für denjenigen gelten, der für die juristische Person handelt. Die Rechtsprechung hat dies über die Jahre so ausgelegt, dass nicht nur der formale Geschäftsführer haftet, sondern auch derjenige, der faktisch die Geschäfte führt, ohne offiziell bestellt zu sein – eben der faktische Geschäftsführer.
Die Kernfrage im Fall von Herrn K. war also: Wann ist jemand ein solcher faktischer Geschäftsführer und damit als Täter strafbar?
Die neue Linie des BGH: Funktionale Betrachtung statt Checkliste
Der BGH stellte klar: Entscheidend ist nicht, ob jemand formale Kriterien erfüllt, die für ein laufendes Unternehmen typisch sind. Entscheidend ist vielmehr, ob die Person nach den konkreten Umständen des Einzelfalls die tatsächliche unternehmerische Leitung innehatte und geschäftsführertypische Aufgaben wahrnahm. Es bedarf einer Gesamtschau der tatsächlichen Verhältnisse.
Im Fall der Firmenbestattung sei das Geschäftsmodell gerade nicht auf die Fortführung des Betriebs, auf Personalmanagement oder Außenkontakte ausgerichtet. Ziel sei die Abwicklung, die Vermögensabschöpfung und die Umgehung der Insolvenzantragspflicht. Daher sei es ohne Aussagekraft, dass Herr K. keine Mitarbeiter einstellte oder keine Geschäftsbeziehungen gestaltete – Derartiges fiel in den Unternehmen nicht mehr an.
Stattdessen müsse man prüfen, in welchem Umfang er im Unternehmen tatsächlich zu erledigende organtypische Aufgaben übernahm. Und genau hier sah der BGH die entscheidende Rolle von Herrn K.: Er kontrollierte den Informationsfluss, er sorgte für die Funktionsunfähigkeit des Strohmanns, er initiierte die Vermögensentziehung und er verhinderte die Insolvenzanträge. Das waren die zentralen geschäftsführertypischen Aufgaben in dieser spezifischen Phase der Firmenbestattung.
Interne Macht reicht aus – Außenwirkung nicht immer nötig
Besonders wichtig ist die Klarstellung des BGH zur Außenwirkung: Während frühere Urteile oft betonten, dass eine gewisse Vertretungsmacht nach außen zu den Essentialia (wesentlichen Merkmalen) einer Organstellung gehöre, relativiert der BGH dies nun für Fälle der Firmenbestattung. Diese frühere Rechtsprechung sei an Fällen werbender, also aktiv am Markt tätiger Unternehmen entwickelt worden.
Bei einer Firmenbestattung, die primär auf interne Abwicklung und Verschleierung abzielt, können auch rein interne, für Dritte nicht sichtbare Steuerungshandlungen ausreichen, um eine faktische Organstellung zu begründen. Wer intern die Kontrolle hat, wer die wesentlichen Entscheidungen trifft und durchsetzt – auch wenn dies im Verborgenen geschieht –, kann als faktischer Geschäftsführer gelten.
Einblick: BGH verwirft starre Kriterien
Das Kernproblem, das der BGH adressiert: Starre Checklisten für die faktische Geschäftsführung greifen zu kurz, wenn Kriminelle gezielt Strukturen schaffen, um genau diese Kriterien zu umgehen.
Die Richter betonen: Es kommt nicht darauf an, ob jemand alle klassischen Aufgaben eines Geschäftsführers übernimmt, sondern ob er die maßgebliche Herrschaft über das unternehmerische Geschehen ausübt – angepasst an die konkrete Situation des Unternehmens (z. B. Abwicklungsphase bei Firmenbestattung). Interne Dominanz und Steuerung können ausreichen, um als Täter nach § 14 StGB zu haften, auch wenn der Außenauftritt fehlt. Die funktionale Betrachtung (Wer tut tatsächlich was?) schlägt die formale (Wer steht auf dem Papier?).
Die Folgen des Urteils: Höheres Risiko für Strippenzieher
Die Entscheidung des BGH hat erhebliche praktische Auswirkungen:
- Höheres Risiko für Hintermänner: Personen, die wie Herr K. im Hintergrund agieren und Unternehmen über Strohmänner steuern, können nun deutlich leichter als Täter von Insolvenzdelikten belangt werden. Die Einstufung als Täter (statt nur als Gehilfe) führt in der Regel zu härteren Strafen und hat auch Konsequenzen für mögliche Berufsverbote oder die persönliche Haftung.
- Neue Ermittlungsansätze: Staatsanwaltschaften und Polizei müssen ihre Ermittlungen stärker auf die Aufklärung der internen Macht- und Entscheidungsstrukturen ausrichten. Es reicht nicht mehr aus, festzustellen, dass der Beschuldigte keine Verträge nach außen unterzeichnet hat. Es muss detailliert ermittelt werden, wer intern die Anweisungen gab, wer über die Finanzen bestimmte, wer den Informationsfluss kontrollierte. Beweismittel wie interne E-Mails, Zeugenaussagen von Mitarbeitern oder des Strohmanns sowie die Analyse von Geldflüssen gewinnen an Bedeutung.
- Herausforderung für die Verteidigung: Strafverteidiger können sich nicht mehr allein darauf zurückziehen, dass ihr Mandant keine formale Geschäftsführerposition innehatte oder nicht nach außen aufgetreten ist. Die Verteidigungsstrategie muss sich darauf konzentrieren, substantiiert darzulegen, dass der Mandant eben keine maßgebliche interne Kontrolle oder Entscheidungsbefugnis besaß. Der Nachweis, dass andere Personen die wesentlichen Entscheidungen trafen oder der Mandant nur eine untergeordnete beratende Rolle spielte, wird entscheidend.
- Signalwirkung für die Wirtschaft: Das Urteil sendet ein klares Signal: Der Missbrauch formaler gesellschaftsrechtlicher Strukturen zur Verschleierung von Verantwortung wird nicht toleriert. Wer faktisch die Kontrolle ausübt, trägt auch die strafrechtliche Verantwortung.
- Mögliche Ausstrahlung auf Berater? Obwohl das Urteil sich auf den Fall des Firmenbestatters bezieht, wirft es die Frage auf, inwieweit die Grundsätze auch auf andere Akteure übertragen werden könnten. Externe Berater, beispielsweise Sanierungs- oder Restrukturierungsexperten, die in Krisensituationen sehr starken Einfluss nehmen, müssen aufpassen, nicht die Grenze von der Beratung zur faktischen Leitung zu überschreiten. Wo diese Grenze genau verläuft, muss die zukünftige Rechtsprechung klären.
Praktische Tipps: Augen auf in der Unternehmenskrise
Für Geschäftsführer und Gesellschafter in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist die Botschaft des Urteils klar: Vorsicht vor vermeintlich einfachen Auswegen!
- Warnsignale für unseriöse Angebote: Seien Sie extrem misstrauisch, wenn Ihnen jemand anbietet, Ihre überschuldete GmbH „problemlos“ und „diskret“ zu übernehmen, oft gegen Zahlung eines Betrags durch Sie. Insbesondere wenn der Käufer im Ausland sitzt oder Strohmänner einsetzt, sollten alle Alarmglocken schrillen.
- Pflicht zur Insolvenzanmeldung ernst nehmen: Geschäftsführer einer GmbH oder UG sind gesetzlich verpflichtet, spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen (§ 15a InsO). Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflicht droht eine Strafbarkeit wegen Insolvenzverschleppung (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).
- Keine Vermögenswerte verschieben: Wenn die Insolvenz droht oder bereits eingetreten ist, ist es absolut tabu, Vermögenswerte der Gesellschaft beiseitezuschaffen, zu verheimlichen oder zu zerstören. Dies erfüllt den Tatbestand des Bankrotts (§ 283 StGB) und kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden.
- Transparenz und Kooperation: Der einzige legale Weg aus der Unternehmenskrise führt über eine geordnete Abwicklung oder Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Kooperieren Sie mit dem Insolvenzverwalter und legen Sie alle relevanten Informationen offen.
- Frühzeitig professionellen Rat suchen: Sobald sich finanzielle Schwierigkeiten abzeichnen, sollten Sie umgehend qualifizierten Rechtsrat bei einem auf Insolvenzrecht spezialisierten Anwalt oder einem erfahrenen Sanierungsberater einholen. Diese können die Situation analysieren und legale Handlungsoptionen aufzeigen.
Do’s & Don’ts bei drohender Insolvenz:
✅ DOs
- Frühzeitig die wirtschaftliche Lage prüfen (lassen).
- Bei Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung sofort handeln.
- Innerhalb der 3‑Wochen‑Frist Insolvenzantrag stellen (§ 15a InsO).
- Professionellen Rat (Anwalt, Berater) einholen.
- Vermögenswerte der Firma sichern und dokumentieren.
- Mit (potenziellen) Insolvenzverwaltern kooperieren.
- Gläubiger gleichmäßig behandeln (keine bevorzugten Zahlungen).
❌ DON’Ts
- Warnsignale ignorieren (Zahlungsstockungen, Mahnungen).
- Auf Zeit spielen und hoffen, dass sich das Problem von selbst löst.
- Die Frist zur Antragstellung verstreichen lassen (Strafbarkeit!).
- Auf „Firmenbestatter“ oder dubiose „Retter“ hereinfallen.
- Vermögen beiseiteschaffen, verheimlichen oder an nahestehende Personen übertragen.
- Wichtige Unterlagen vernichten oder Buchführung manipulieren.
- Kurz vor der Insolvenz einzelne Gläubiger bevorzugt befriedigen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema
Was ist eine Firmenbestattung genau und warum ist sie problematisch?
Eine Firmenbestattung bezeichnet die Übernahme einer insolvenzreifen oder überschuldeten Gesellschaft durch Dritte, die nicht an der Sanierung interessiert sind. Ziel ist meist, verbliebene Vermögenswerte abzuschöpfen und die gesetzlichen Pflichten (insbesondere die Insolvenzantragspflicht) zu umgehen. Dies geschieht oft durch den Einsatz von Strohmann-Geschäftsführern. Problematisch ist dies, weil Gläubiger geschädigt werden und die Verantwortlichen sich der Strafverfolgung entziehen wollen. Es handelt sich um eine Form der Wirtschaftskriminalität.
Bin ich ein faktischer Geschäftsführer, auch wenn ich nicht im Handelsregister stehe?
Ja, das ist möglich. Nach dem BGH-Urteil kommt es nicht auf die formale Bestellung an, sondern darauf, ob Sie tatsächlich die maßgebliche unternehmerische Leitung ausüben. Wenn Sie die wesentlichen Entscheidungen treffen, die Geschicke der Firma lenken und intern die Kontrolle haben (auch ohne Außenwirkung), können Sie als faktischer Geschäftsführer gelten und haften wie ein offiziell bestellter Geschäftsführer, insbesondere bei Insolvenzdelikten.
Was ist der Unterschied zwischen Täter und Gehilfe bei Insolvenzstraftaten?
Der Täter ist derjenige, der die Straftat selbst begeht oder arbeitsteilig mit anderen zusammenwirkt (Mittäterschaft) und dabei eine zentrale Rolle spielt (Tatherrschaft). Bei Insolvenzdelikten ist dies typischerweise der (faktische) Geschäftsführer. Der Gehilfe (oder Teilnehmer) leistet dem Täter lediglich Hilfe bei der Tat, ohne sie selbst maßgeblich zu steuern. Die Strafandrohung für den Täter ist in der Regel höher als für den Gehilfen. Das BGH-Urteil erleichtert die Einordnung von Hintermännern als Täter.
Welche Aufgaben sind „geschäftsführertypisch“ laut dem neuen BGH-Urteil?
Der BGH sagt: Was typisch ist, hängt vom konkreten Zustand und Zweck der Gesellschaft ab. In einem laufenden Betrieb sind das z. B. Personal-, Finanz-, Vertrags- und Strategieentscheidungen. Bei einer Firma in der Abwicklungsphase (wie bei der Firmenbestattung) sind die entscheidenden geschäftsführertypischen Aufgaben die Kontrolle über die Abwicklung selbst: Vermögensverwaltung (oder -entziehung), Steuerung des Informationsflusses, Entscheidung über die (Nicht-)Stellung des Insolvenzantrags. Auch rein interne Steuerungsakte zählen.
Wann genau muss ich als Geschäftsführer Insolvenz anmelden?
Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags besteht unverzüglich, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder der Überschuldung (§ 19 InsO). Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn das Unternehmen fällige Zahlungspflichten nicht mehr erfüllen kann. Überschuldung liegt bei juristischen Personen vor, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt (es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist überwiegend wahrscheinlich).
Welche Strafen drohen bei Bankrott oder Insolvenzverschleppung?
Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bankrott (§ 283 StGB) kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet werden. In besonders schweren Fällen (z.B. gewerbsmäßiges Handeln) sind auch höhere Strafen möglich. Neben den strafrechtlichen Folgen drohen oft auch zivilrechtliche Haftungsansprüche und ein Verbot, künftig als Geschäftsführer tätig zu sein.
Fazit: Substanz schlägt Form – Keine Toleranz für Verschleierung
Das Urteil des Bundesgerichtshofs 5 StR 287/24 ist ein klares Stoppsignal für alle, die glauben, sich durch formale Konstruktionen und den Einsatz von Strohmännern der strafrechtlichen Verantwortung entziehen zu können. Die Richter haben unmissverständlich klargemacht: Wer faktisch die Kontrolle über ein Unternehmen ausübt und dessen Geschicke lenkt, haftet auch als Täter für Insolvenzstraftaten – unabhängig vom offiziellen Titel oder dem Auftreten nach außen.
Die Entscheidung stärkt die Position der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen komplexe Wirtschaftskriminalität und schützt die Interessen von Gläubigern und dem redlichen Geschäftsverkehr. Sie betont den Vorrang der materiellen Wahrheit vor formalen Fassaden.
Für Unternehmer und Geschäftsführer bedeutet dies einmal mehr: In der Krise sind Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und die Einhaltung gesetzlicher Pflichten der einzig richtige Weg. Der Versuch, sich durch eine Firmenbestattung aus der Affäre zu ziehen, ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern birgt nach dieser BGH-Entscheidung mehr denn je erhebliche strafrechtliche Risiken für alle Beteiligten, insbesondere für die eigentlichen Drahtzieher im Hintergrund. Der Fall des Herrn K. wird nun vor dem Landgericht Leipzig unter Berücksichtigung dieser neuen, strengeren Maßstäbe neu aufgerollt werden müssen.