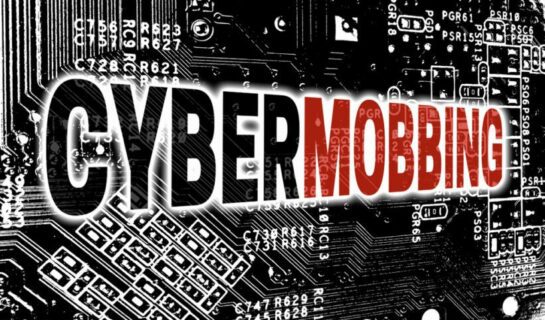Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Gerichtsurteil klärt Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe beim Enkel-Trick
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- FAQ – Häufige Fragen
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Mittäterschaft und Beihilfe bei Betrug?
- Wie kann man beurteilen, ob jemand als Mittäter oder als Gehilfe am Betrug beteiligt war?
- Welche möglichen Strafen drohen bei Mittäterschaft beziehungsweise Beihilfe zum Betrug?
- Welche Rolle spielt der Tatbeitrag eines Beteiligten bei der Beurteilung als Mittäter oder Gehilfe?
- Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Opfer von Betrug, um ihre Rechte zu schützen und sich vor weiteren Schäden zu bewahren?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Der Angeklagte wurde ursprünglich wegen gemeinschaftlichen Betrugs verurteilt, die Entscheidung wurde jedoch in der Revision geändert auf Beihilfe zum Betrug.
- Die Revision des Angeklagten wurde teilweise erfolgreich, da das Amtsgericht nicht ausreichend Beweise für Mittäterschaft vorlegte.
- Der Angeklagte hatte eine unterstützende Rolle bei der Durchführung eines Betrugs, indem er Geld von einem geschädigten älteren Herrn entgegennahm.
- Der Geschädigte fühlte sich durch einen Anruf des Angeklagten, der sich als Rechtsanwalt ausgab, unter Druck gesetzt, eine Geldsumme zu überweisen.
- Die Beweislage ergab, dass der Angeklagte keine eigene tragende Rolle im Betrug hatte, sondern lediglich an der Durchführung des Plans beteiligt war.
- Ein wichtiger Aspekt der Entscheidung ist die Unterscheidung zwischen der Mittäterschaft und der Beihilfe, die sich durch die Bedeutung des Beitrags zur Tat zeigt.
- Das Gericht stellte fest, dass der Angeklagte nicht aktiv am Plan teilnahm, sondern nur eine untergeordnete Funktion übernahm.
- Die Entscheidung hat Bedeutung für die Rechtsprechung in ähnlichen Fällen, insbesondere bei der Abgrenzung von Täterschaft und Beihilfe im Betrugsrecht.
- Der Fall unterstreicht die Risiken, die mit der unwissentlichen Unterstützung von Betrügereien verbunden sind, sowie die rechtlichen Konsequenzen für Beteiligte.
- Die weitere Verhandlung wird über die Strafe und die Kosten des Verfahrens entscheiden, was die rechtlichen Auseinandersetzungen für den Angeklagten noch nicht abschließt.
Gerichtsurteil klärt Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe beim Enkel-Trick
Betrug, insbesondere in seinen vielfältigen Erscheinungsformen wie dem „Enkel-Trick“, stellt ein zentrales Problem für die Strafjustiz dar. Dabei ist es für die rechtliche Einordnung und die Strafbarkeit von Tätergruppen entscheidend, die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe zu klären. Mittäterschaft setzt voraus, dass mehrere Personen gemeinschaftlich einen Straftatbestand verwirklichen, während Beihilfe eine untergeordnete Rolle in Form der Unterstützung der Tat darstellt. Im Falle des „Enkel-Tricks“ etwa lässt sich die Frage stellen, ob derjenige, der das Opfer anruft und als Enkel täuscht, oder derjenige, der später das Geld abholt, als Mittäter oder als Gehilfe anzusehen ist.
Die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe ist im Einzelfall oft schwierig, da es auf die konkrete Tatbeteiligung und die Absprache der Beteiligten ankommt. Die Gerichte müssen dabei die jeweiligen Tatbeiträge der Beteiligten genauestens prüfen, um festzustellen, ob diese den Tatentschluss gemeinschaftlich gefasst haben oder ob der eine nur den anderen unterstützt hat. Wie diese Abgrenzung in der Praxis zu erfolgen hat, zeigt ein aktuelles Gerichtsurteil, das wir im folgenden näher beleuchten wollen.
Unsicherheit über Ihre Rolle in einem Betrugsfall?
Wurden Sie wie Herr D. in eine unglückliche Situation verwickelt und sind unsicher über Ihre rechtliche Position? Wir verstehen die Komplexität der Rechtslage und bieten Ihnen eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihres Falls. Unsere langjährige Erfahrung im Strafrecht ermöglicht es uns, Ihre Beteiligung präzise einzuordnen und Ihre Rechte zu wahren. Zögern Sie nicht, den ersten Schritt zu machen und uns zu kontaktieren – Ihre Zukunft liegt uns am Herzen.
Der Fall vor Gericht
Betrügerische Geldüberweisung durch falsche Rechtsanwaltsidentität

Der Fall behandelt einen Betrug, bei dem ein älterer Mann durch einen falschen Rechtsanwalt zu einer Geldüberweisung gedrängt wurde. Am 14. Februar 2012 erhielt der 80-jährige Geschädigte einen betrügerischen Anruf. Der Anrufer gab sich als „Rechtsanwalt M.“ aus und behauptete, der Geschädigte hätte einen Vertrag mit einer „Win-AG“ abgeschlossen. Um angeblich seine Daten löschen zu lassen, sollte der Geschädigte 2.800 Euro an einen Herrn D. überweisen.
Dem älteren Mann wurde vorgegaukelt, die Angelegenheit könne nur außergerichtlich geklärt werden. Durch diese Täuschung und aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen überwies der Geschädigte den geforderten Betrag per Geldtransfer an den Angeklagten D. Dieser erschien kurz darauf bei der Reisebank, wies sich mit seinem Personalausweis aus und ließ sich das Geld auszahlen.
Die rechtliche Herausforderung in diesem Fall liegt in der Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe zum Betrug. Es musste geklärt werden, welche Rolle der Angeklagte D. bei dem Betrug spielte und wie sein Tatbeitrag strafrechtlich zu bewerten ist.
Rechtliche Bewertung der Tatbeteiligung als Beihilfe
Das Kammergericht Berlin hat in seinem Beschluss vom 19. Oktober 2015 die rechtliche Einordnung des Tatbeitrags des Angeklagten D. überprüft. Ursprünglich war D. vom Amtsgericht Tiergarten wegen „gemeinschaftlichen Betruges“ verurteilt worden. Das Kammergericht kam jedoch zu dem Schluss, dass die Feststellungen des Amtsgerichts lediglich eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Betrug rechtfertigen.
Für eine Mittäterschaft wäre laut Gericht ein wesentlicher Tatbeitrag während des Ausführungsstadiums der Tat erforderlich gewesen. Der Tatbeitrag des Angeklagten beschränkte sich jedoch darauf, dass er sich im Vorfeld bereit erklärt hatte, das per Geldtransfer überwiesene Geld in Empfang zu nehmen. Die eigentliche Tathandlung – der betrügerische Anruf und die dadurch bewirkte Überweisung – war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.
Das Gericht betonte, dass der Betrug bereits mit der Belastung des Kontos des Geschädigten vollendet war. Die anschließende Entgegennahme des Geldes durch den Angeklagten stellte daher nur eine untergeordnete Unterstützungshandlung dar, die als Beihilfe zu werten ist.
Mangelnde Einbindung in die Tatplanung als entscheidender Faktor
Ein wichtiger Aspekt für die rechtliche Bewertung war die fehlende Einbindung des Angeklagten in die Tatplanung. Das Gericht stellte fest, dass keine ausreichenden Erkenntnisse darüber vorlagen, inwieweit der Angeklagte in die Details der Tat eingeweiht war oder ob er an der Tatbeute beteiligt werden sollte.
Diese mangelnde Kenntnis der Tatumstände sprach gegen eine Mittäterschaft, bei der der Beteiligte einen eigenen wesentlichen Beitrag zur gemeinschaftlichen Tat leistet. Stattdessen deuteten die Umstände darauf hin, dass der Angeklagte lediglich einen fördernden Beitrag zur Erlangung der Tatbeute durch die Haupttäter geleistet hatte.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte zwar möglicherweise nicht alle Details der Tat kannte, aber zumindest billigend in Kauf genommen hatte, dass das überwiesene Geld betrügerisch erlangt worden war. Diese Einschätzung reichte für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Betrug aus.
Änderung des Schuldspruchs und Konsequenzen für das Strafmaß
Aufgrund dieser rechtlichen Neubewertung änderte das Kammergericht Berlin den Schuldspruch von Mittäterschaft auf Beihilfe zum Betrug. Diese Änderung hatte erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß. Da Beihilfe in der Regel milder bestraft wird als eine täterschaftliche Begehung, hob das Gericht den ursprünglichen Strafausspruch auf.
Die Sache wurde zur Neuverhandlung des Strafmaßes an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zurückverwiesen. Bei der Neufestsetzung der Strafe muss nun berücksichtigt werden, dass der Angeklagte nicht als Mittäter, sondern als Gehilfe verurteilt wurde. Dies wird sich voraussichtlich strafmildernd auswirken.
Für die Betroffenen von Betrugsdelikten zeigt dieser Fall, wie wichtig die genaue rechtliche Einordnung der Tatbeteiligung ist. Auch wenn jemand an einem Betrug mitwirkt, bedeutet das nicht automatisch eine Verurteilung als Mittäter. Die genauen Umstände der Beteiligung und der Grad der Einbindung in die Tat sind entscheidend für die strafrechtliche Bewertung und das resultierende Strafmaß.
Die Schlüsselerkenntnisse
Die Entscheidung verdeutlicht die präzise Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe beim Betrug. Für eine Mittäterschaft ist ein wesentlicher Tatbeitrag während des Ausführungsstadiums erforderlich, während untergeordnete Unterstützungshandlungen nach Vollendung der Tat als Beihilfe zu werten sind. Der Grad der Einbindung in die Tatplanung und die Kenntnis der Tatumstände sind entscheidend für die strafrechtliche Bewertung. Diese Differenzierung hat erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß und unterstreicht die Bedeutung einer genauen rechtlichen Einordnung der Tatbeteiligung.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Dieses Urteil ist für Sie als potenzielles Betrugsopfer oder besorgter Bürger von Bedeutung, da es die Grenzen der strafrechtlichen Verantwortung bei Betrugsfällen aufzeigt. Es verdeutlicht, dass nicht jeder, der an einem Betrug beteiligt ist, automatisch als Haupttäter gilt. Wenn Sie Opfer eines Betrugs werden, ist es wichtig zu verstehen, dass möglicherweise nicht alle Beteiligten gleich schwer bestraft werden. Personen, die nur untergeordnete Aufgaben erfüllen, wie das Abholen von Geld, können als Gehilfen eingestuft werden und erhalten in der Regel mildere Strafen. Dies kann Ihnen helfen, die Rollen der verschiedenen Beteiligten besser einzuschätzen und realistische Erwartungen an die strafrechtliche Verfolgung zu entwickeln. Gleichzeitig unterstreicht das Urteil, dass auch scheinbar kleine Beiträge zu einem Betrug strafbar sind, was Sie ermutigen sollte, verdächtige Aktivitäten zu melden.
FAQ – Häufige Fragen
Häufig werden wir mit Fragen zu den komplexen Themen Betrug und Strafrecht konfrontiert. Um Ihnen eine zuverlässige und verständliche Orientierung zu bieten, haben wir diese FAQ-Rubrik zusammengestellt. Hier finden Sie umfassende Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen und wertvolle Informationen, die Ihnen helfen, sich besser zurechtzufinden.
Wichtige Fragen, kurz erläutert:
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Mittäterschaft und Beihilfe bei Betrug?
- Wie kann man beurteilen, ob jemand als Mittäter oder als Gehilfe am Betrug beteiligt war?
- Welche möglichen Strafen drohen bei Mittäterschaft beziehungsweise Beihilfe zum Betrug?
- Welche Rolle spielt der Tatbeitrag eines Beteiligten bei der Beurteilung als Mittäter oder Gehilfe?
- Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Opfer von Betrug, um ihre Rechte zu schützen und sich vor weiteren Schäden zu bewahren?
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Mittäterschaft und Beihilfe bei Betrug?
Die Unterscheidung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe bei Betrug ist von großer rechtlicher Bedeutung. Bei der Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 StGB verwirklichen mehrere Personen gemeinschaftlich den Tatbestand. Sie tragen die Tatherrschaft gemeinsam und leisten jeweils einen wesentlichen Tatbeitrag. Dieser kann in der Planung, Vorbereitung oder Durchführung der Tat liegen. Entscheidend ist, dass der Beitrag für den Erfolg der Tat von erheblicher Bedeutung ist.
Im Gegensatz dazu liegt eine Beihilfe nach § 27 StGB vor, wenn jemand dem Haupttäter bei der Begehung der Tat Hilfe leistet, ohne selbst Täter zu sein. Der Gehilfe fördert die Tat des Haupttäters, ohne die Tatherrschaft innezuhaben. Seine Handlungen sind für den Taterfolg nicht wesentlich, sondern unterstützend.
Bei einem Betrug könnte eine Mittäterschaft beispielsweise vorliegen, wenn zwei Personen gemeinsam einen komplexen Plan zur Täuschung eines Opfers ausarbeiten und umsetzen. Beide tragen hier wesentlich zum Gelingen der Tat bei. Eine Beihilfe läge hingegen vor, wenn jemand dem Haupttäter lediglich Informationen über das Opfer beschafft, ohne selbst an der Täuschungshandlung beteiligt zu sein.
Ein wichtiges Kriterium zur Abgrenzung ist der Grad der Tatherrschaft. Mittäter haben die Möglichkeit, den Ablauf und Erfolg der Tat maßgeblich zu beeinflussen. Sie können die Tat „zum Scheitern bringen“. Gehilfen fehlt diese Einflussmöglichkeit, sie unterstützen lediglich die Handlungen des Haupttäters.
Auch das Eigeninteresse an der Tat spielt eine Rolle. Mittäter verfolgen in der Regel ein eigenes Interesse am Taterfolg, während Gehilfen oft nur aus Gefälligkeit handeln. Bei einem Betrug könnte sich dies in der Aufteilung der erlangten Vermögenswerte zeigen. Erhalten alle Beteiligten einen wesentlichen Anteil, spricht dies für Mittäterschaft. Erhält ein Beteiligter nur eine geringe „Aufwandsentschädigung“, deutet dies eher auf Beihilfe hin.
Die zeitliche Komponente kann ebenfalls relevant sein. Mittäter sind in der Regel von Beginn an in die Planung und Durchführung der Tat eingebunden. Gehilfen kommen oft erst später hinzu und leisten punktuelle Unterstützung.
Im Rahmen eines Betruges könnte eine Beihilfehandlung darin bestehen, dem Haupttäter gefälschte Dokumente zur Verfügung zu stellen, die dieser für die Täuschung des Opfers benötigt. Eine mittäterschaftliche Handlung wäre hingegen die aktive Beteiligung an der Täuschung des Opfers, etwa durch überzeugendes Auftreten als vermeintlicher Geschäftspartner.
Die rechtliche Einordnung hat erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß. Mittäter werden wie Alleintäter bestraft, während bei Gehilfen die Strafe nach § 27 Abs. 2 StGB gemildert wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Abgrenzung im Einzelfall.
Es ist zu beachten, dass die Grenzen zwischen Mittäterschaft und Beihilfe fließend sein können. Gerichte müssen oft eine Gesamtwürdigung aller Umstände vornehmen, um zu einer angemessenen Einordnung zu gelangen. Dabei spielen Faktoren wie die Intensität der Tatbeteiligung, das Ausmaß der Tatherrschaft und die subjektive Einstellung des Beteiligten eine wichtige Rolle.
Wie kann man beurteilen, ob jemand als Mittäter oder als Gehilfe am Betrug beteiligt war?
Die Beurteilung, ob jemand als Mittäter oder als Gehilfe am Betrug beteiligt war, erfordert eine sorgfältige Prüfung verschiedener Faktoren. Entscheidend ist dabei vor allem der Grad der Tatbeteiligung und die Stellung des Beteiligten im Gesamtgefüge der Tat.
Bei der Mittäterschaft fügt der Beteiligte seinen eigenen Tatbeitrag so in die Tat ein, dass er als Teil der Handlung eines anderen Beteiligten erscheint und umgekehrt dessen Handeln als Ergänzung des eigenen Tatanteils gesehen werden kann. Der Mittäter hat in der Regel ein eigenes Interesse am Taterfolg und übt zumindest teilweise Tatherrschaft aus. Er ist maßgeblich an der Planung und Durchführung der Tat beteiligt, sodass der Ausgang der Tat wesentlich von seinem Willen abhängt.
Im Gegensatz dazu beschränkt sich die Rolle des Gehilfen auf eine unterstützende Funktion. Der Gehilfe fördert lediglich die Haupttat eines anderen, ohne selbst die Tatherrschaft innezuhaben oder ein ausgeprägtes Eigeninteresse am Taterfolg zu haben. Seine Handlungen sind eher untergeordneter Natur und nicht entscheidend für den Erfolg der Tat.
Ein anschauliches Beispiel verdeutlicht diesen Unterschied: Bei einem fingierten Verkehrsunfall zur Erlangung von Versicherungsleistungen wurde eine Person, die sich lediglich als vermeintliche Fahrerin eines Unfallfahrzeugs ausgab, als Gehilfin eingestuft. Ihr Beitrag war zwar wichtig für die Vorbereitung des Betrugs, aber sie hatte weder die Täuschungshandlung selbst vorgenommen noch ein eigenes Interesse am Taterfolg.
Für die Beurteilung als Mittäter sind folgende Kriterien besonders relevant:
1. Der Umfang der Tatbeteiligung: Je umfangreicher und bedeutsamer der Beitrag zur Tat ist, desto eher liegt Mittäterschaft vor.
2. Das eigene Interesse am Taterfolg: Ein starkes Eigeninteresse spricht für Mittäterschaft.
3. Die Tatherrschaft oder der Wille dazu: Wenn der Beteiligte Einfluss auf den Ablauf und das Ergebnis der Tat hat, deutet dies auf Mittäterschaft hin.
4. Die Einbindung in die Tatplanung: Eine intensive Beteiligung an der Planung der Tat ist ein Indiz für Mittäterschaft.
Es ist wichtig zu beachten, dass Mittäterschaft nicht zwingend eine Mitwirkung am Kerngeschehen erfordert. Auch ein die Tatbestandsverwirklichung fördernder Beitrag, der sich auf Vorbereitungs- oder Unterstützungshandlungen beschränkt, kann für eine Mittäterschaft ausreichen. Entscheidend ist, dass sich diese Mitwirkung nach der Willensrichtung des Beteiligten als Teil der Tätigkeit aller darstellt.
Im Gegensatz dazu liegt Beihilfe vor, wenn sich die Mitwirkung nach der Vorstellung des Beteiligten in einer bloßen Förderung fremden Handelns erschöpft. Der Gehilfe handelt mit dem Bewusstsein, durch sein Verhalten das Vorhaben des Haupttäters zu unterstützen, ohne jedoch selbst die Tatherrschaft innezuhaben oder maßgeblich am Erfolg der Tat interessiert zu sein.
Die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe erfordert stets eine wertende Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei müssen die genannten Kriterien sorgfältig gegeneinander abgewogen werden, um zu einer angemessenen rechtlichen Einordnung zu gelangen.
Welche möglichen Strafen drohen bei Mittäterschaft beziehungsweise Beihilfe zum Betrug?
Bei Betrug drohen je nach Schwere der Tat und Beteiligungsform unterschiedliche Strafen. Für Mittäter gelten grundsätzlich dieselben Strafrahmen wie für den Haupttäter. Der einfache Betrug wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bei Mittäterschaft kann also ebenfalls eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden.
Die Beihilfe zum Betrug wird dagegen milder bestraft. Hier sieht das Gesetz eine obligatorische Strafmilderung vor. Das bedeutet, dass die Höchststrafe für Gehilfen auf drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe begrenzt ist. In vielen Fällen wird die Strafe für Beihilfe noch deutlich darunter liegen.
Für die konkrete Strafzumessung spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. Das Gericht berücksichtigt unter anderem die Höhe des verursachten Schadens, die kriminelle Energie, das Motiv und die Vorstrafen des Täters. Auch das Nachtatverhalten wie ein Geständnis oder Schadenswiedergutmachung kann sich strafmildernd auswirken.
Bei gewerbsmäßigem Betrug oder als Mitglied einer Bande drohen deutlich höhere Strafen. Hier sieht das Gesetz einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Dies gilt sowohl für Mittäter als auch – in abgemilderter Form – für Gehilfen.
Die Rechtsprechung hat für bestimmte Betrugsformen Strafmaßtabellen entwickelt. So wird etwa beim Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen ab einem Schaden von 50.000 Euro in der Regel eine Freiheitsstrafe verhängt. Bei Schäden in Millionenhöhe drohen mehrjährige Haftstrafen.
Neben der Freiheits- oder Geldstrafe kommen weitere Rechtsfolgen in Betracht. Das Gericht kann die Einziehung der erlangten Vermögenswerte anordnen. Zudem droht unter Umständen ein Berufsverbot.
Bei der Strafzumessung berücksichtigt das Gericht auch die Rolle des jeweiligen Beteiligten. Ein Mittäter, der maßgeblich zur Planung und Durchführung beigetragen hat, muss mit einer höheren Strafe rechnen als jemand, der nur eine untergeordnete Funktion hatte. Gehilfen werden in der Regel milder bestraft als Mittäter.
Im Einzelfall kann die Strafe auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die verhängte Freiheitsstrafe zwei Jahre nicht übersteigt und eine günstige Sozialprognose besteht. Bei der Beihilfe kommt eine Bewährungsstrafe häufiger in Betracht als bei Mittäterschaft.
Welche Rolle spielt der Tatbeitrag eines Beteiligten bei der Beurteilung als Mittäter oder Gehilfe?
Bei der Beurteilung, ob ein Beteiligter als Mittäter oder Gehilfe einzustufen ist, spielt der konkrete Tatbeitrag eine entscheidende Rolle. Die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe erfolgt anhand des Umfangs und der Bedeutung der jeweiligen Handlung für die Verwirklichung des Tatbestands.
Ein wesentlicher Tatbeitrag liegt vor, wenn der Beteiligte einen maßgeblichen Einfluss auf die Durchführung und den Erfolg der Straftat hat. Dies ist typischerweise der Fall, wenn er an der Planung und Ausführung der Tat aktiv mitwirkt und eine gewisse Tatherrschaft ausübt. Bei Betrugsdelikten kann sich ein wesentlicher Tatbeitrag beispielsweise darin äußern, dass jemand gezielt falsche Informationen verbreitet, um das Opfer zu täuschen, oder eine zentrale Rolle bei der Entgegennahme und Weiterleitung von betrügerisch erlangten Geldern einnimmt.
Im Gegensatz dazu stellt eine untergeordnete Unterstützungshandlung lediglich eine Hilfeleistung dar, die für die Tatbegehung zwar förderlich, aber nicht ausschlaggebend ist. Der Gehilfe leistet hier nur einen nebensächlichen Beitrag, ohne direkten Einfluss auf den Kerngeschehensablauf zu nehmen. Bei Betrugsfällen könnte dies etwa das Bereitstellen von Informationen über potenzielle Opfer oder das Zur-Verfügung-Stellen eines Fahrzeugs für den Transport von Tatbeteiligten sein.
Die Unterscheidung zwischen wesentlichem Tatbeitrag und untergeordneter Unterstützungshandlung lässt sich gut am Beispiel eines Computerbetrugs veranschaulichen: Wenn eine Person gezielt Waren mit unrechtmäßig erlangten Kreditkartendaten bestellt und eine andere diese Waren in Empfang nimmt und weiterleitet, liegt in der Regel Mittäterschaft vor. Beide Personen leisten hier wesentliche Tatbeiträge, da sie arbeitsteilig und planmäßig zusammenwirken, um den Betrug zu verwirklichen.
Würde hingegen jemand lediglich seine Adresse für die Warenlieferung zur Verfügung stellen, ohne genau zu wissen, worum es sich handelt, und ohne aktiv an der Planung oder Durchführung des Betrugs beteiligt zu sein, käme eher eine Einstufung als Gehilfe in Betracht. Hier läge eine untergeordnete Unterstützungshandlung vor, da die Person zwar die Tat erleichtert, aber keinen bestimmenden Einfluss auf deren Ablauf hat.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Grenze zwischen Mittäterschaft und Beihilfe oft fließend ist und im Einzelfall sorgfältig geprüft werden muss. Entscheidend sind dabei nicht nur objektive Kriterien wie der Umfang der Tatbeteiligung, sondern auch subjektive Aspekte wie der Grad des eigenen Interesses am Taterfolg und der Wille zur Tatherrschaft.
Bei Betrugsfällen, insbesondere bei komplexeren Strukturen wie dem sogenannten Enkeltrick, ist eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Tatbeiträge unerlässlich. Während derjenige, der den täuschenden Anruf tätigt, in der Regel als Mittäter einzustufen ist, könnte die Person, die lediglich das Geld abholt, je nach Kenntnisstand und Einbindung in die Gesamttat als Mittäter oder Gehilfe beurteilt werden.
Die rechtliche Einordnung als Mittäter oder Gehilfe hat erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß. Mittäter werden als Haupttäter bestraft, während bei Gehilfen eine obligatorische Strafmilderung nach § 27 Abs. 2 StGB in Verbindung mit § 49 Abs. 1 StGB erfolgt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Analyse des individuellen Tatbeitrags in jedem Einzelfall.
Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Opfer von Betrug, um ihre Rechte zu schützen und sich vor weiteren Schäden zu bewahren?
Betrugsopfer haben verschiedene rechtliche Möglichkeiten, um ihre Rechte zu schützen und weitere Schäden abzuwenden. Eine zentrale Option ist die Erstattung einer Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft. Dies leitet nicht nur strafrechtliche Ermittlungen ein, sondern dokumentiert den Vorfall auch offiziell, was für spätere zivilrechtliche Schritte nützlich sein kann.
Im Rahmen des Strafverfahrens können Opfer als Nebenkläger auftreten. Dies ermöglicht eine aktivere Beteiligung am Prozess, einschließlich des Rechts auf Akteneinsicht, Anwesenheit bei Vernehmungen und das Stellen von Beweisanträgen. Besonders bei schwerwiegenden Fällen kann dies die Position des Opfers stärken.
Parallel zum Strafverfahren oder unabhängig davon können Betrugsopfer zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Hierzu gehört insbesondere die Forderung nach Schadensersatz. Die rechtliche Grundlage hierfür findet sich oft in den §§ 823 und 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), die eine Haftung für vorsätzliche sittenwidrige Schädigungen vorsehen.
Ein wichtiges Instrument zum Schutz vor weiteren Schäden ist das Gewaltschutzgesetz. Obwohl primär für Fälle häuslicher Gewalt konzipiert, kann es in bestimmten Betrugsfällen Anwendung finden, etwa wenn der Täter dem Opfer persönlich bekannt ist. Es ermöglicht die Beantragung von Schutzanordnungen wie Kontakt- oder Näherungsverbote beim zuständigen Amtsgericht.
Für Opfer von Gewalttaten, zu denen in manchen Fällen auch Betrugsdelikte zählen können, sieht das Opferentschädigungsgesetz staatliche Unterstützungsleistungen vor. Diese können von der Übernahme von Heilbehandlungskosten bis hin zu Rentenleistungen reichen.
Um finanzielle Schäden zu begrenzen, ist schnelles Handeln oft entscheidend. Betrugsopfer sollten umgehend ihre Bank informieren, um mögliche Transaktionen zu stoppen oder rückgängig zu machen. Bei Online-Betrug ist zudem die Meldung an Plattformbetreiber oder Zahlungsdienstleister ratsam, um Täterkonten zu sperren.
Zur Beweissicherung ist es wichtig, alle relevanten Unterlagen und Kommunikationen zu dokumentieren. Dies umfasst E-Mails, Chatnachrichten, Verträge und Zahlungsbelege. Diese Dokumentation kann sowohl für strafrechtliche Ermittlungen als auch für zivilrechtliche Ansprüche von Bedeutung sein.
Betrugsopfer sollten auch die Unterstützung von Opferhilfeorganisationen in Betracht ziehen. Diese bieten oft kostenlose Beratung und können bei der Navigation durch rechtliche und behördliche Prozesse helfen. Der WEISSE RING e.V. ist eine bekannte Anlaufstelle, die bundesweit Opfern von Straftaten beisteht.
In komplexeren Fällen oder wenn höhere Summen im Spiel sind, kann die Beauftragung eines spezialisierten Rechtsanwalts sinnvoll sein. Dieser kann nicht nur bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen, sondern auch präventiv beraten, um zukünftige Betrugsversuche zu verhindern.
Es ist zu beachten, dass für die Geltendmachung von Ansprüchen Verjährungsfristen gelten. Diese variieren je nach Art des Anspruchs und den Umständen des Falls. Generell ist es ratsam, möglichst zeitnah nach Entdeckung des Betrugs rechtliche Schritte einzuleiten.
Betrugsopfer sollten sich bewusst sein, dass sie im Strafverfahren bestimmte Informationsrechte haben. Dazu gehört das Recht, über den Fortgang des Verfahrens informiert zu werden, einschließlich einer möglichen Einstellung oder des Ausgangs einer Gerichtsverhandlung.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Tatentschluss: Der Entschluss, eine Straftat zu begehen. Er ist ein innerer Vorgang und bezieht sich auf den Willen, die Tat auszuführen. Im vorliegenden Fall fassten die Betrüger den Tatentschluss, den älteren Mann durch einen falschen Anruf zu täuschen und ihn zur Zahlung zu bewegen.
- Ausführungsstadium: Die Phase, in der die eigentliche Straftat begangen wird. Sie beginnt mit der ersten konkreten Handlung zur Umsetzung des Tatentschlusses und endet mit der Vollendung der Tat. Im vorliegenden Fall begann das Ausführungsstadium mit dem Anruf des falschen Anwalts und endete mit der Überweisung des Geldes.
- Vollendung der Tat: Der Zeitpunkt, zu dem alle objektiven Tatbestandsmerkmale einer Straftat erfüllt sind. Beim Betrug ist dies der Moment, in dem der Getäuschte sein Vermögen durch die Täuschung verloren hat, unabhängig davon, ob der Täter den Vorteil bereits erlangt hat. Im vorliegenden Fall war der Betrug mit der Belastung des Kontos des Opfers vollendet.
- Tatbeteiligung: Die Mitwirkung an einer Straftat. Es gibt verschiedene Formen der Tatbeteiligung, wie Täterschaft und Teilnahme. Die Täterschaft umfasst Täter und Mittäter, die den Tatentschluss gemeinsam fassen und die Tat ausführen. Die Teilnahme umfasst Anstiftung und Beihilfe, wobei der Teilnehmer den Täter unterstützt, ohne selbst Täter zu sein. Im vorliegenden Fall war der Angeklagte nicht an der Planung des Betrugs beteiligt, sondern half nur bei der Ausführung, indem er das Geld entgegennahm.
- Strafmaß: Die Höhe der Strafe, die ein Gericht für eine Straftat verhängt. Das Strafmaß richtet sich nach der Schwere der Tat und der Schuld des Täters. Bei der Festsetzung des Strafmaßes berücksichtigt das Gericht auch die Umstände der Tat und die Persönlichkeit des Täters. Im vorliegenden Fall hatte die Einordnung der Tatbeteiligung als Beihilfe Auswirkungen auf das Strafmaß, da Beihilfe in der Regel milder bestraft wird als Mittäterschaft.
- Billigend in Kauf nehmen: Eine Form des Vorsatzes, bei der der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges für möglich hält und sich damit abfindet. Im vorliegenden Fall nahm der Angeklagte billigend in Kauf, dass das Geld, das er entgegennahm, durch Betrug erlangt wurde, obwohl er vielleicht nicht alle Details der Tat kannte.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 263 StGB (Betrug): Betrug ist die vorsätzliche Täuschung über Tatsachen, die einen Irrtum erregt, wodurch eine Vermögensverfügung des Getäuschten bewirkt wird, die diesen oder einen Dritten am Vermögen schädigt. Im vorliegenden Fall täuschte der Anrufer den Geschädigten über seine Identität und über die Notwendigkeit einer Zahlung, um einen angeblichen Vertrag aufzulösen.
- § 27 StGB (Beihilfe): Beihilfe ist die vorsätzliche Hilfeleistung zur Begehung einer Straftat durch einen anderen. Der Gehilfe unterstützt den Haupttäter bei der Tatbegehung, ohne selbst Täter zu sein. Im vorliegenden Fall nahm der Angeklagte das Geld entgegen, das durch den Betrug erlangt wurde, und leistete damit Beihilfe.
- § 25 StGB (Mittäterschaft): Mittäterschaft liegt vor, wenn mehrere Personen gemeinschaftlich eine Straftat begehen. Sie setzen gemeinsam den Tatentschluss um und wirken arbeitsteilig zusammen. Im vorliegenden Fall wurde geprüft, ob der Angeklagte Mittäter war, da er das Geld entgegennahm. Das Gericht verneinte dies jedoch, da sein Beitrag nicht ausreichend für eine Mittäterschaft war.
- § 354 StPO (Änderung des Schuldspruchs): Die Strafprozessordnung regelt das Verfahren vor Gericht. § 354 StPO erlaubt es dem Gericht, den Schuldspruch zu ändern, wenn die Feststellungen nicht ausreichen, um den ursprünglichen Schuldspruch zu tragen, aber eine Verurteilung wegen einer anderen Straftat rechtfertigen. Im vorliegenden Fall änderte das Gericht den Schuldspruch von Mittäterschaft zu Beihilfe.
- § 265 StPO (Verbot der reformatio in peius): Das Verbot der reformatio in peius besagt, dass sich die Rechtsmittel eines Angeklagten nicht zu seinem Nachteil auswirken dürfen. Im vorliegenden Fall wurde geprüft, ob die Änderung des Schuldspruchs gegen dieses Verbot verstößt. Das Gericht entschied, dass dies nicht der Fall ist, da der Angeklagte sich nicht anders verteidigt hätte, wenn er von Anfang an wegen Beihilfe angeklagt gewesen wäre.
Das vorliegende Urteil
KG Berlin – Az.: (2) 161 Ss 220/15 (63/15) – Beschluss vom 19.10.2015
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.
→ Lesen Sie hier den vollständigen Urteilstext…
1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin vom 13. Mai 2015
a) im Schuldspruch dahin geändert, dass der Angeklagte wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt wird,
b) im Strafausspruch mit den zugehörigen Feststellungen aufgehoben.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere Abteilung des Amtsgerichts Tiergarten zurückverwiesen.
2. Die weitergehende Revision wird verworfen.
Gründe
I.
Das Amtsgericht Tiergarten in Berlin hat den Angeklagten am 13. Mai 2015 wegen „gemeinschaftlichen Betruges“ zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 15,00 Euro verurteilt.
Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte rechtzeitig Revision eingelegt. Er rügt die Verletzung materiellen Rechts. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Verwerfung der Revision als offensichtlich unbegründet beantragt.
II.
Die in zulässiger Weise eingelegte Revision ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet, im Übrigen ist sie unbegründet im Sinne von § 349 Abs. 2 StPO. Die Feststellungen des Amtsgerichts tragen den Schuldspruch wegen einer täterschaftlichen Beteiligung am Betrug nicht. Sie begründen lediglich eine Verurteilung wegen Beihilfe (§ 27 StGB) zum Betrug (§ 263 StGB).
1. Das Amtsgericht hat zur Sache im Wesentlichen folgende Feststellungen getroffen:
„Am 14.2.2012 gegen 11.00 Uhr erhielt der damals 80 Jahre alte Geschädigte E. in seiner Wohnung … einen Anruf. Es meldete sich eine ihm nicht bekannte männliche Person, die sich als ‚Rechtsanwalt M.‘ vorstellte und ihm mitteilte, dass er, der Geschädigte, mit einer ‚Win-AG‘ einen Vertrag abgeschlossen hätte. Der Geschädigte sei aufgefordert worden, einen Betrag von 2.450,00 Euro (richtig: 2.800,00 Euro [sic]) zu zahlen, damit seine Daten gelöscht werden könnten. Die Überweisung sollte an einen Herrn D. [den Angeklagten] bis zwölf Uhr erfolgen. Eingezahlt werden sollte der Betrag über das Geldtransferunternehmen W. Bank. Dem Geschädigten ist vorgegaukelt worden, dass die Sache nur außergerichtlich geklärt werden könnte. Der Geschädigte war durch diesen Anruf derart überrumpelt, dass er sich zu Gegenfragen nicht in der Lage sah. Ihm wurde der Eindruck vermittelt, bei Nichtzahlung müsse er vor Gericht. Aus Angst vor möglichen Konsequenzen einer Nichtzahlung begab sich der Geschädigte zu seiner Postbankfiliale …. Dort wies er unter der Geldtransferkontrollnummer … die Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von 2.800,00 Euro zugunsten des Angeklagten … an. Noch am selben Tage nach Eingang der Überweisung erschien bei der Reisebank die von der W. Bank betrieben wird, der Angeklagte und wies sich durch Vorlage seines Personalausweises als dieser aus und erhielt den Geldbetrag des Geschädigten ausgehändigt. Der betreffende Mitarbeiter der Reisebank hielt die Personalangaben, die ausstellende Behörde, die Anschrift des Angeklagten und die Gültigkeitsdauer des Personalausweises schriftlich fest. Das Geld behielt der Angeklagte entweder für sich oder, was wahrscheinlicher ist, reichte es an diejenigen Personen weiter, die ihn veranlasst hatten, die Geldabholung vorzunehmen und die ihn mit seinem Namen dem Geschädigten als Geldempfänger angegeben hatten.“
Aus dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe entnimmt der Senat, dass sich der Angeklagte, der im Vorbereitungsstadium angesprochen worden war, ob er bereit wäre, Geld das ihm per W. Bank überwiesen werden würde, entgegenzunehmen und an den/die Haupttäter selbst oder dessen/deren Beauftragten weiterzureichen, dazu bereit erklärt hat.
2. Die getroffenen Feststellungen reichen für die Annahme einer Mittäterschaft des Angeklagten nicht aus.
Mittäterschaft setzt die Leistung eines durch einen gemeinsamen Tatplan festgelegten Beitrags zur Tatbestandsverwirklichung voraus (vgl. Heine/Weißer in: Schönke/Schröder, StGB 29. Aufl., § 25 Rdn. 62). Ein wesentlicher Tatbeitrag während des Ausführungsstadiums der Tat begründet regelmäßig den Vorwurf (mit-) täterschaftlicher Beteiligung, während Beiträge von untergeordneter Bedeutung als Beihilfe zu bewerten sind (vgl. BGH StraFo 2009, 344). Mittäter ist, wer nicht nur fremdes Tun fördert, sondern einen eigenen Beitrag derart in eine gemeinschaftliche Tat einfügt, dass dieser als Teil der Tätigkeit des anderen und umgekehrt dessen Tun als Ergänzung seines eigenen Tatanteils erscheint. Ob ein Beteiligter ein so enges Verhältnis zur Tat hat, ist nach den gesamten Umständen, die von seiner Vorstellung umfasst sind, in wertender Betrachtung zu beurteilen (vgl. BGH NStZ 2007, 531). Wesentliche Anhaltspunkte können der Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille zur Tatherrschaft sein; Durchführung und Ausgang der Tat müssen somit zumindest aus der subjektiven Sicht des Tatbeteiligten maßgeblich auch von seinem Willen abhängen. Dabei deutet eine ganz untergeordnete Tätigkeit schon objektiv darauf hin, dass der Beteiligte nur Gehilfe ist (st. Rspr.; vgl. BGH NStZ 2005, 228; BGH StraFo 2009, 344). Hinzu kommt, dass (sukzessive) Mittäterschaft nach Vollendung des Betruges, eher fernliegt (vgl. BGH wistra 2001, 378, offen gelassen von BGH wistra 2007, 258; Perron in: Schönke/Schröder, StGB 29. Aufl., § 263 Rdn. 180: „nicht mehr möglich“).
Der festgestellte Tatbeitrag des Angeklagten beschränkt sich hier auf seine im (straflosen) Vorfeld der Tat geäußerte Bereitschaft, das per W. Bank angewiesene Geld in Empfang zu nehmen und die Umsetzung dieser Bereitschaft nach Vollendung des Betruges. Der Betrug war mit der Belastung des Kontos des Geschädigten vollendet, denn für die Vollendung reicht es, dass der Vermögensschaden eingetreten ist; nicht erforderlich ist, dass auch der angestrebte Vermögensvorteil erlangt wird (vgl. BGH MDR 1984, 508, 509 = BGH, Urteil vom 25. Januar 1984 – 3 StR 278/83 – [juris]).
Beihilfe kommt insbesondere bei untergeordneten Unterstützungshandlungen (bis zur Beendigung der Tat) in Betracht, z.B. wenn der Angeklagte eine betrügerisch erlangte Geldsumme in Kenntnis der Umstände an den Täter weiterleitet (vgl. BGH wistra 2000, 459 = BGH, Urteil vom 14. Juli 2000 – 3 StR 454/99 – [juris]).
In Ermangelung weiterer Feststellungen zur subjektiven Tatseite – insbesondere zur Einbindung des Angeklagten in die Tatplanung und zur Beteiligung an der Tatbeute – liegt in dem festgestellten objektiven Tatbeitrag des Angeklagten (nur) ein ausreichendes Indiz für einen vorsätzlich fördernden Beitrag zur Erlangung der Tatbeute durch den/die Haupttäter. Wenngleich nicht feststeht, ob der Angeklagte in die Details der Tat eingeweiht war, sprechen die festgestellten Umstände seiner Beteiligung doch dafür, dass er (auch) eine betrügerische Erlangung des überwiesenen Betrages zumindest billigend in Kauf genommen hat.
Der Senat schließt aus, dass in einer neuen Verhandlung noch tragfähige Feststellungen für einen mittäterschaftlich begangenen Betrug getroffen werden können und hat deshalb in entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO den Schuldspruch selbst geändert. § 265 StPO steht dem nicht entgegen. Es ist nicht ersichtlich, dass der Angeklagte, der den Tatvorwurf pauschal bestritten hat, sich gegen den Vorwurf einer gehilfenschaftlichen Beteiligung anders hätte verteidigen können (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 58. Aufl., § 354 Rdn. 16).
3. Die Änderung des Schuldspruchs hat die Aufhebung des Strafausspruchs zur Folge. Im Umfang der Aufhebung war die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung – auch über die Kosten der Revision – an eine andere Abteilung des Amtsgerichts zurückzuverweisen (§ 354 Abs. 2 Satz 1 StPO).