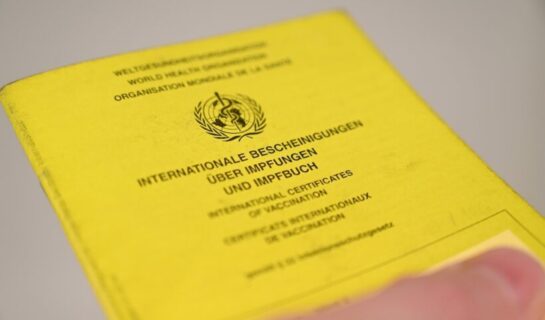Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Freispruch trotz gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Frau wegen psychischer Erkrankung nach § 20 StGB schuldlos
- Suizidversuch auf Autobahn führt zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und hohem Sachschaden
- War die Frau zum Tatzeitpunkt schuldfähig? Kernfrage nach § 20 StGB im Fokus des Gerichts
- Amtsgericht Olpe spricht Frau frei: Freispruch aus rechtlichen Gründen trotz festgestellter Tat
- Begründung des Freispruchs: Vollständige Schuldunfähigkeit wegen schwerer psychischer Erkrankung nach § 20 StGB
- Keine Unterbringung in Psychiatrie nach § 63 StGB: Geringe Wiederholungsgefahr nach erfolgreicher Therapie
- Führerschein nicht dauerhaft entzogen: Keine aktuelle Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nach § 69 StGB festgestellt
- Keine Entschädigung für vorläufigen Führerscheinentzug: Ausschlussgrund nach StrEG bei Schuldunfähigkeit
- Kostenentscheidung: Landeskasse trägt Verfahrenskosten gemäß § 467 StPO
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Schuldunfähigkeit im strafrechtlichen Sinne?
- Welche psychischen Erkrankungen können zu einer Schuldunfähigkeit führen?
- Wie wird die Schuldunfähigkeit einer Person vor Gericht festgestellt?
- Was bedeutet ein Freispruch „aus rechtlichen Gründen“ genau?
- Welche Konsequenzen hat ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 50 Ls-67 Js 938/20-21 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Amtsgericht Olpe
- Datum: 29.03.2022
- Aktenzeichen: 50 Ls-67 Js 938/20-21/21
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die Staatsanwaltschaft, die die Anklage erhob.
- Beklagte: Die angeklagte Person.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Die angeklagte Person fuhr mit ihrem Auto auf eine Autobahn, stellte es auf dem Standstreifen ab, stieg aus und lief in suizidaler Absicht vor einen Lastwagen. Es kam zur Kollision, bei der die angeklagte Person verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging darum, ob die angeklagte Person zum Zeitpunkt der Tat wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war und welche straf- und maßregelrechtlichen Folgen sich daraus ergeben.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die angeklagte Person wurde freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Landeskasse.
- Begründung: Der Freispruch erfolgte aus rechtlichen Gründen, weil die angeklagte Person zur Tatzeit nach Ansicht eines Sachverständigen aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig im Sinne des Gesetzes war. Die Fähigkeit, das Unrecht des Handelns einzusehen, war vollständig aufgehoben.
Der Fall vor Gericht
Freispruch trotz gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Frau wegen psychischer Erkrankung nach § 20 StGB schuldlos
Das Amtsgericht Olpe hat in einem aufsehenerregenden Fall eine Frau freigesprochen, der ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt wurde. Obwohl sich der Vorfall wie von der Staatsanwaltschaft beschrieben ereignet hatte, kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Frau zum Tatzeitpunkt aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Diese Entscheidung, basierend auf dem Aktenzeichen 50 Ls-67 Js 938/20-21/21 vom 29. März 2022, beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen psychischer Gesundheit, Strafrecht und Verkehrssicherheit.
Suizidversuch auf Autobahn führt zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und hohem Sachschaden
Der Vorfall, der dem Gerichtsverfahren zugrunde lag, ereignete sich an einem Nachmittag gegen 15:45 Uhr in T. auf der Bundesautobahn N03 in Fahrtrichtung M.

Die beschuldigte Frau fuhr mit ihrem Pkw auf die Autobahn und stellte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen bei Streckenkilometer N04 ab. Nach dem Aussteigen betrat sie die Fahrbahn und lief in suizidaler Absicht direkt vor ein herannahendes LKW-Gespann. Der Fahrer dieses LKW, der Zeuge K., leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß erheblich verletzt.
Die Situation eskalierte weiter, als ein nachfolgendes LKW-Gespann auf das bremsende Fahrzeug des Zeugen K. auffuhr. Glücklicherweise wurden bei diesem Folgeunfall keine weiteren Personen verletzt. Allerdings entstand durch die Kollisionen ein erheblicher Sachschaden, der vom Gericht auf insgesamt circa 300.000 Euro beziffert wurde. Die Staatsanwaltschaft Q. klagte die Frau daraufhin wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315b StGB an.
War die Frau zum Tatzeitpunkt schuldfähig? Kernfrage nach § 20 StGB im Fokus des Gerichts
Die zentrale Frage, mit der sich das Amtsgericht Olpe auseinandersetzen musste, war die der Schuldfähigkeit der Frau zum Zeitpunkt des Vorfalls. Konkret ging es darum, ob die Frau aufgrund ihres psychischen Zustandes nach § 20 des Strafgesetzbuches (StGB) als schuldfähig oder schuldunfähig einzustufen war. Diese Feststellung ist entscheidend, da Schuldunfähigkeit einen gesetzlichen Schuldausschließungsgrund darstellt und somit einer strafrechtlichen Verurteilung entgegensteht. Eng damit verbunden waren weitere Fragen zu möglichen Rechtsfolgen: Hätte die Frau ihre Fahrerlaubnis dauerhaft verlieren müssen? Wäre eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen gewesen? Und hatte sie Anspruch auf Entschädigung für die vorläufige Sicherstellung ihres Führerscheins?
Amtsgericht Olpe spricht Frau frei: Freispruch aus rechtlichen Gründen trotz festgestellter Tat
Das Gericht fällte eine klare Entscheidung: Die Frau wurde freigesprochen. Dies geschah ausdrücklich aus rechtlichen Gründen, obwohl das Gericht den von der Staatsanwaltschaft geschilderten und durch die Beweisaufnahme bestätigten Sachverhalt als erwiesen ansah. Der Freispruch bedeutet nicht, dass die Tat als solche nicht stattgefunden hat, sondern dass die Frau rechtlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann. Konsequenterweise wurden die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen der freigesprochenen Frau der Landeskasse auferlegt, wie es § 467 der Strafprozessordnung (StPO) bei Freisprüchen vorsieht.
Begründung des Freispruchs: Vollständige Schuldunfähigkeit wegen schwerer psychischer Erkrankung nach § 20 StGB
Die Begründung für den Freispruch stützte sich maßgeblich auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Dr. S. Dessen Ausführungen überzeugten das Gericht davon, dass die Frau zur Tatzeit schuldlos im Sinne des § 20 StGB gehandelt hat. Der Sachverständige diagnostizierte bei der Frau eine komplexe psychische Erkrankung: Zum einen litt sie an einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung. Zum anderen befand sie sich zum Tatzeitpunkt in einer schweren depressiven Episode im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung.
Dieses Krankheitsbild wertete der Gutachter als krankhafte seelische Störung, eines der Eingangsmerkmale des § 20 StGB. Aufgrund der außergewöhnlichen Schwere dieser psychischen Beeinträchtigung war nach Überzeugung des Sachverständigen und des Gerichts die Fähigkeit der Frau, das Unrecht ihres Tuns einzusehen, zum Tatzeitpunkt vollständig aufgehoben. Sie konnte also nicht erkennen oder steuern, dass ihr Handeln falsch war. Folglich war sie schuldunfähig, was zwingend zum Freispruch führen musste.
Keine Unterbringung in Psychiatrie nach § 63 StGB: Geringe Wiederholungsgefahr nach erfolgreicher Therapie
Obwohl die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wurde, prüfte das Gericht auch, ob eine Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB erforderlich sei. Diese Maßregel der Besserung und Sicherung kann angeordnet werden, wenn von einer Person aufgrund ihres Zustandes die Gefahr weiterer erheblicher rechtswidriger Taten ausgeht.
Das Gericht entschied sich jedoch gegen eine solche Unterbringung und auch gegen eine Verweisung des Falls an das zuständige Landgericht zur Entscheidung darüber. Ausschlaggebend war hier erneut die Einschätzung des Sachverständigen Dr. S. Dieser kam zu dem Schluss, dass die Begehung weiterer rechtswidriger Taten durch die Frau zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung nicht naheliegend sei. Seine Prognose stützte er darauf, dass sich die Frau nach dem Vorfall einer längeren stationären fachpsychiatrischen Behandlung unterzogen hatte, die sich über mehrere Monate erstreckte (genaue Daten wurden im Urteil anonymisiert). Anschließend befand sie sich in ambulanter psychiatrischer Nachbetreuung. Diese umfangreichen therapeutischen Maßnahmen hätten zu einer Stabilisierung ihres Zustandes geführt. Diese positive Einschätzung wurde zudem durch die Aussage der behandelnden ambulanten Psychiaterin, Frau Dr. L., bestätigt. Daher sah das Gericht keine Grundlage für die Annahme einer gegenwärtigen Gefährlichkeit, die eine Unterbringung rechtfertigen würde.
Führerschein nicht dauerhaft entzogen: Keine aktuelle Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nach § 69 StGB festgestellt
Eine weitere wichtige Frage war, ob der Frau die Fahrerlaubnis gemäß § 69 StGB dauerhaft entzogen werden müsse. Diese Maßnahme wird angeordnet, wenn sich jemand durch eine rechtswidrige Tat als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen hat. Auch hier entschied das Gericht zugunsten der Frau und sah von einer Entziehung der Fahrerlaubnis ab.
Die Begründung hierfür lag ebenfalls in der positiven Entwicklung nach der Tat. Da sich die Frau der erfolgreichen vollstationären und anschließenden ambulanten psychiatrischen Behandlung unterzogen hatte, konnte das Gericht zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung nicht mehr davon ausgehen, dass sie ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen sei. Die Einschätzung des Sachverständigen, dass keine naheliegende Gefahr weiterer Straftaten bestehe, stützte auch diese Entscheidung. Eine charakterliche Ungeeignetheit konnte ebenfalls nicht festgestellt werden.
Zusätzlich berücksichtigte das Gericht, dass der Zusammenhang zwischen der Tat selbst und dem Führen eines Kraftfahrzeugs eher mittelbarer Natur war. Die Frau hatte ihren Pkw zwar benutzt, um zum Tatort auf der Autobahn zu gelangen und ihn dort abgestellt. Die eigentliche Tathandlung – das Betreten der Fahrbahn vor den LKW – erfolgte jedoch zu Fuß und nicht unter Nutzung des Fahrzeugs im Sinne einer „Fahr“-Handlung. Dies schwächte die Anwendbarkeit des § 69 Abs. 1 S. 1 StGB zusätzlich ab.
Keine Entschädigung für vorläufigen Führerscheinentzug: Ausschlussgrund nach StrEG bei Schuldunfähigkeit
Im Laufe des Ermittlungsverfahrens war der Führerschein der Frau sichergestellt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden. Obwohl sie nun freigesprochen wurde, sprach ihr das Gericht keine Entschädigung für diese Strafverfolgungsmaßnahmen zu.
Dies begründete das Gericht mit der Vorschrift des § 6 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG). Diese Regelung schließt eine Entschädigung ausdrücklich aus, wenn ein Beschuldigter nur deshalb nicht verurteilt wird, weil er die ihm zur Last gelegte Straftat im Zustand der zur Tatzeit bestehenden Schuldunfähigkeit begangen hat. Da der Freispruch der Frau genau auf dieser Grundlage – der Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB – beruhte, bestand kein Anspruch auf finanzielle Kompensation für den Zeitraum, in dem sie ihren Führerschein nicht nutzen konnte.
Kostenentscheidung: Landeskasse trägt Verfahrenskosten gemäß § 467 StPO
Die abschließende Entscheidung über die Kosten des Verfahrens folgte der allgemeinen Regel bei Freisprüchen. Gemäß § 467 StPO fallen die Kosten des gerichtlichen Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen der freigesprochenen Person der Staatskasse zur Last. Dies unterstreicht den Grundsatz, dass niemand die Kosten eines Verfahrens tragen soll, in dem seine Unschuld oder – wie hier – seine fehlende strafrechtliche Verantwortlichkeit festgestellt wird.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass eine Person trotz nachweislicher Gefährdung des Straßenverkehrs freigesprochen werden kann, wenn sie zum Tatzeitpunkt aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig im Sinne des § 20 StGB war. Die wesentliche Erkenntnis ist, dass für eine Strafbarkeit nicht nur die objektive Tathandlung, sondern auch die persönliche Schuldfähigkeit vorliegen muss. Bedeutsam ist zudem, dass nach erfolgreicher Therapie weder eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung noch der Entzug der Fahrerlaubnis erfolgen musste, da keine aktuelle Gefährlichkeit mehr bestand.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet Schuldunfähigkeit im strafrechtlichen Sinne?
Wenn wir von Schuldunfähigkeit im Strafrecht sprechen, geht es darum, ob eine Person zum Zeitpunkt einer Straftat persönlich für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden kann.
Stellen Sie sich vor, jemand begeht eine Handlung, die nach dem Gesetz eine Straftat wäre. Trotzdem kann es sein, dass diese Person dafür keine Schuld im rechtlichen Sinne trägt. Das ist der Fall, wenn bei der Person zur Tatzeit eine so schwere Störung vorlag – zum Beispiel eine psychische Krankheit, eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung oder eine schwere Intelligenzminderung.
Diese Störung muss dazu geführt haben, dass die Person nicht in der Lage war, das Unrecht ihrer Handlung zu verstehen. Sie konnte also nicht erkennen, dass das, was sie tat, falsch oder gesetzwidrig war (man spricht von fehlender Einsichtsfähigkeit).
Oder die Person konnte das Unrecht ihrer Handlung zwar verstehen, war aber nicht in der Lage, sich entsprechend dieser Einsicht zu verhalten. Sie wusste, dass es falsch ist, konnte ihren Willen oder ihre Handlungen aber wegen der Störung nicht steuern (man spricht von fehlender Steuerungsfähigkeit).
Dieser Grundsatz ist im deutschen Strafrecht im Paragraph 20 des Strafgesetzbuches (StGB) geregelt. Er besagt, dass jemand, der wegen einer solchen schweren Beeinträchtigung zur Tatzeit nicht schuldfähig war, nicht bestraft werden kann.
Für Sie bedeutet das: Schuldunfähigkeit schließt die Bestrafung aus, weil dem Betroffenen die persönliche Vorwerfbarkeit fehlt. Das Gesetz sieht in solchen Fällen jedoch vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen Maßregeln zur Besserung und Sicherung angeordnet werden können – zum Beispiel die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus –, wenn von der Person weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Hier steht nicht die Strafe im Vordergrund, sondern der Schutz der Öffentlichkeit und die Behandlung der zugrundeliegenden Ursache.
Welche psychischen Erkrankungen können zu einer Schuldunfähigkeit führen?
Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht jede psychische Erkrankung automatisch dazu führt, dass jemand im rechtlichen Sinne schuldunfähig ist. Schuldunfähigkeit bedeutet im Strafrecht, dass jemand zum Zeitpunkt einer Tat aufgrund einer schweren seelischen Beeinträchtigung nicht oder nur sehr eingeschränkt in der Lage war, das Unrecht seines Handelns zu erkennen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Das regelt in Deutschland der § 20 des Strafgesetzbuchs.
Wann kann eine psychische Erkrankung relevant sein?
Damit eine psychische Erkrankung zur Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit führen kann, muss sie die Fähigkeit einer Person, das Geschehen richtig zu beurteilen (Einsichtsfähigkeit) oder ihr Verhalten zu steuern (Steuerungsfähigkeit), erheblich beeinträchtigen oder vollständig aufheben. Stellen Sie sich das so vor: Kann die Person aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr begreifen, dass etwas falsch ist, oder kann sie, obwohl sie es vielleicht versteht, ihren Impulsen oder Zwangsvorstellungen nicht widerstehen?
Beispiele für relevante Erkrankungen
Bestimmte schwere psychische Erkrankungen oder Zustände können eine solche Beeinträchtigung hervorrufen. Dazu gehören beispielsweise:
- Schwere Formen von Psychosen, wie bei der Schizophrenie, die mit Wahnvorstellungen oder Halluzinationen einhergehen und den Kontakt zur Realität stark verzerren können.
- Tiefgreifende Bewusstseinsstörungen, wie sie etwa bei schweren Vergiftungen, deliranten Zuständen oder nach schweren Hirnverletzungen auftreten können.
- Schwere affektive Störungen, wie eine sehr schwere depressive Episode oder eine manische Phase im Rahmen einer bipolaren Störung, wenn sie die Fähigkeit zur Steuerung des eigenen Handelns massiv beeinträchtigen.
- Schwerer Schwachsinn oder fortgeschrittene Demenzerkrankungen, die das geistige Leistungsvermögen extrem reduzieren.
- Andere schwere seelische Abartigkeiten, die vergleichbar tiefgreifende Auswirkungen auf Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit haben.
Wichtigkeit der Einzelfallprüfung durch Sachverständige
Entscheidend ist immer der Grad der Beeinträchtigung zum Zeitpunkt der Tat, nicht nur die Existenz einer Diagnose. Die Beurteilung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist stets eine komplexe Einzelfallentscheidung. Gerichte ziehen hierfür in aller Regel ein Gutachten eines erfahrenen psychiatrischen oder psychologischen Sachverständigen heran. Dieser Sachverständige untersucht die betreffende Person und die Umstände der Tat genau, um eine Einschätzung der seelischen Verfassung und ihrer Auswirkungen auf die Fähigkeiten zur Tatzeit abzugeben.
Wie wird die Schuldunfähigkeit einer Person vor Gericht festgestellt?
Wenn ein Gericht die Schuldunfähigkeit einer Person prüfen muss, weil es Anzeichen dafür gibt, dass die Person zum Zeitpunkt einer Tat ihre Fähigkeiten beeinträchtigt war, folgt das einem bestimmten Ablauf. Ziel ist es festzustellen, ob die Person in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen oder danach zu handeln.
Einschaltung eines psychiatrischen Sachverständigen
Weil die Frage der Schuldunfähigkeit oft medizinische oder psychische Ursachen hat, die das Gericht nicht selbst beurteilen kann, wird in der Regel ein psychiatrischer Sachverständiger (ein spezialisierter Arzt oder Psychologe) vom Gericht beauftragt. Dieser Sachverständige ist ein Experte auf diesem Gebiet.
Der Sachverständige hat die Aufgabe, die betreffende Person zu untersuchen. Dazu spricht er ausführlich mit der Person, wertet eventuell vorhandene medizinische Unterlagen aus und zieht bei Bedarf weitere Informationen heran. Auf Basis dieser Untersuchung und aller verfügbaren Informationen erstellt der Sachverständige ein Gutachten. In diesem Gutachten legt er seine Einschätzung dar, wie der psychische Zustand der Person zum Zeitpunkt der Tat war und ob dieser Zustand die Fähigkeiten zur Einsicht oder Steuerung des eigenen Verhaltens beeinflusst hat.
Bewertung des Gutachtens durch das Gericht
Dieses Gutachten des Sachverständigen wird dem Gericht vorgelegt. Es ist ein wichtiges Beweismittel im Verfahren. Das Gericht prüft das Gutachten sorgfältig.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das Gericht nicht automatisch an das Ergebnis des Gutachtens gebunden ist. Der Sachverständige gibt eine medizinische oder psychologische Einschätzung ab. Die endgültige Entscheidung darüber, ob jemand schuldfähig, vermindert schuldfähig oder schuldunfähig war, trifft aber immer das Gericht selbst. Es ist eine rechtliche Entscheidung, die auf allen gesammelten Beweisen basiert.
In der Praxis orientieren sich Gerichte jedoch häufig stark an den Schlussfolgerungen des Sachverständigengutachtens, insbesondere wenn das Gutachten nachvollziehbar, logisch aufgebaut und überzeugend begründet ist. Wenn das Gutachten klar darlegt, dass aufgrund einer schwerwiegenden psychischen Störung die Fähigkeit zur Einsicht oder Steuerung erheblich beeinträchtigt oder aufgehoben war, wird das Gericht dies bei seiner Entscheidung in der Regel berücksichtigen. Gibt es Zweifel am Gutachten, kann das Gericht Nachfragen stellen oder sogar ein weiteres Gutachten einholen.
Das Gericht würdigt also das Gutachten des Sachverständigen im Rahmen der gesamten Beweisaufnahme und trifft daraufhin seine eigenständige rechtliche Entscheidung über die Schuldfrage.
Was bedeutet ein Freispruch „aus rechtlichen Gründen“ genau?
Ein Freispruch „aus rechtlichen Gründen“ unterscheidet sich deutlich von einem Freispruch, der erfolgt, weil dem Angeklagten die vorgeworfene Tat nicht nachgewiesen werden konnte.
Er bedeutet im Kern: Das Gericht geht davon aus, dass die Handlung, um die es geht, tatsächlich stattgefunden hat, oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Die Person wird aber nicht wegen dieser Handlung bestraft, weil es rechtliche Hindernisse für eine Verurteilung gibt.
Ein häufiger Grund dafür ist die sogenannte Schuldunfähigkeit. Das bedeutet, dass das Gericht festgestellt hat, dass die Person zum Zeitpunkt der Tat aufgrund einer schweren seelischen oder geistigen Störung nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen oder entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Juristisch gesprochen, konnte die Person für ihre Tat nicht verantwortlich gemacht werden.
Es kann aber auch andere „rechtliche Gründe“ für einen Freispruch geben, zum Beispiel, weil die Tat nach sehr langer Zeit verjährt ist.
Für Sie bedeutet ein solcher Freispruch im Strafverfahren: Sie werden nicht strafrechtlich verurteilt und erhalten keine Strafe im Sinne des Strafrechts.
Es ist jedoch wichtig zu verstehen: Da das Gericht annimmt, dass die Handlung stattgefunden hat, hat ein Freispruch aus rechtlichen Gründen keine automatische Auswirkung auf mögliche zivilrechtliche Ansprüche. Wenn durch die Handlung einem anderen Menschen ein Schaden entstanden ist (zum Beispiel Verletzungen oder Sachschäden), kann diese Person möglicherweise trotz des Freispruchs im Strafverfahren zivilrechtlich Schadensersatz von Ihnen verlangen. Dies liegt daran, dass Zivilverfahren und Strafverfahren unterschiedliche Ziele verfolgen und unterschiedliche rechtliche Maßstäbe anlegen.
Welche Konsequenzen hat ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit?
Ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit bedeutet zunächst, dass die betroffene Person nicht im strafrechtlichen Sinne bestraft wird. Im deutschen Recht kann nur bestraft werden, wer zum Zeitpunkt der Tat „schuldfähig“ war. Schuldunfähigkeit liegt vor, wenn jemand aufgrund einer schweren seelischen Krankheit oder einer vergleichbaren Störung nicht verstehen konnte, was er tut, oder nicht in der Lage war, nach diesem Verständnis zu handeln. Weil in solchen Fällen die persönliche Vorwerfbarkeit – die „Schuld“ im strafrechtlichen Sinne – fehlt, erfolgt kein Schuldspruch und damit keine Strafe.
Dennoch bedeutet ein solcher Freispruch nicht zwangsläufig das Ende des gerichtlichen Verfahrens oder, dass keine weiteren staatlichen Maßnahmen ergriffen werden. Wenn eine Person zwar wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wird, aber aufgrund ihres Zustands weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, kann das Gericht sogenannte Maßregeln der Besserung und Sicherung anordnen. Diese Maßnahmen sind keine Strafen, sondern dienen dem Schutz der Öffentlichkeit und, wenn möglich, der Besserung des Zustands der betroffenen Person.
Mögliche Maßnahmen trotz Freispruchs
Zwei häufige Beispiele für solche Maßnahmen sind:
- Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus: Wenn das Gericht feststellt, dass die Person eine rechtswidrige Tat begangen hat und aufgrund ihres Zustands weiterhin gefährlich ist und mit ähnlichen Taten zu rechnen ist, kann eine Unterbringung in einem speziellen Krankenhaus angeordnet werden. Ziel ist hier der Schutz der Allgemeinheit und die Behandlung der Person. Die Dauer der Unterbringung hängt von der Entwicklung des Zustands ab und wird regelmäßig vom Gericht überprüft.
- Entziehung der Fahrerlaubnis: Hat die Person eine Tat im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr begangen (z.B. unter Einfluss von Alkohol oder Drogen) und wird sie wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen, kann ihr dennoch die Fahrerlaubnis entzogen werden, wenn das Gericht feststellt, dass sie ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen ist. Dies dient ebenfalls der Sicherheit im Straßenverkehr.
Diese Maßnahmen werden vom Gericht angeordnet, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind und oft aufgrund von Gutachten von medizinischen oder psychologischen Sachverständigen. Für Sie als Leser bedeutet das: Ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit ist ein wichtiges juristisches Ergebnis, das aber von möglichen weiteren gerichtlichen Entscheidungen über Maßnahmen zur Besserung und Sicherung getrennt betrachtet werden muss.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB
Schuldunfähigkeit liegt vor, wenn eine Person zum Zeitpunkt der Tat wegen einer schweren psychischen Erkrankung oder geistigen Störung nicht in der Lage war, das Unrecht ihres Handelns einzusehen oder ihr Verhalten danach zu steuern. Nach § 20 Strafgesetzbuch (StGB) schließt dies die Strafbarkeit aus, weil die persönliche Vorwerfbarkeit fehlt. Das bedeutet, dass die betroffene Person für ihre Tat rechtlich nicht verantwortlich gemacht werden kann. Diese Regelung schützt Menschen, die durch eine krankhafte seelische Störung vollständig an der Einsichtsfähigkeit oder Steuerungsfähigkeit gehindert sind.
Beispiel: Jemand mit einer schweren psychotischen Störung begeht eine Straftat, kann jedoch wegen der Erkrankung nicht verstehen, dass das Verhalten falsch ist, sodass eine Strafe ausgeschlossen ist.
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB)
Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr ist eine Straftat nach § 315b StGB und umfasst Handlungen, die die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich gefährden, etwa durch das Stören oder Behindern des Verkehrs. Diese Tat muss objektiv die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigen und kann zu Schäden an Personen oder Sachen führen. Es ist kein Schaden erforderlich, die bloße Gefährdung genügt bereits für den Straftatbestand.
Beispiel: Das Betreten der Autobahn als Suizidversuch und das dadurch ausgelöste Auffahren von Fahrzeugen stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar.
Freispruch „aus rechtlichen Gründen“
Ein Freispruch aus rechtlichen Gründen bedeutet, dass das Gericht zwar davon ausgeht, dass der Tatvorwurf bewiesen ist, die verurteilungsrechtlichen Voraussetzungen aber nicht erfüllt sind, sodass eine Strafe nicht verhängt wird. Häufig beruht dies auf gesetzlich geregelten Ausschlussgründen wie der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB). Der Freispruch besagt nicht, dass die Tat nicht stattgefunden hat, sondern dass keine strafrechtliche Verantwortung besteht.
Beispiel: Eine Person begeht eine Straftat, ist aber psychisch so erkrankt, dass sie keiner Schuld fähig ist; sie wird dann freigesprochen, weil das Gesetz dies vorsieht.
Maßregel der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB)
§ 63 StGB erlaubt die Unterbringung einer schuldunfähigen oder vermindert schuldfähigen Person in einem psychiatrischen Krankenhaus, wenn von ihr eine erhebliche Gefahr weiterer Straftaten ausgeht. Diese Maßregel dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Besserung des Täters, ist aber keine Strafe im klassischen Sinn. Die Entscheidung beruht auf einer individuellen Gefährlichkeitsprognose, meist durch psychiatrische Gutachten begründet.
Beispiel: Ein psychisch kranker Straftäter, der nach einem Freispruch immer noch eine ernste Gefahr für andere darstellt, kann zur öffentlichen Sicherheit in einer Klinik untergebracht werden.
Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB)
Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist eine strafrechtliche Nebenfolge nach § 69 StGB, die angeordnet werden kann, wenn eine Person durch eine Straftat als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen gilt. Dies soll die Verkehrssicherheit gewährleisten. Die Maßnahme ist unabhängig von einer Verurteilung und kann auch bei Freispruch aus Schuldunfähigkeit erfolgen, wenn die Eignung zum Führen eines Fahrzeugs nicht mehr gegeben ist.
Beispiel: Wer unter Einfluss einer psychischen Störung eine gefährliche Verkehrssituation verursacht und weiterhin als nicht zuverlässig im Straßenverkehr gilt, kann seinen Führerschein verlieren, selbst wenn die Tat nicht bestraft wird.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 20 StGB (Strafgesetzbuch) – Schuldunfähigkeit wegen psychischer Störung: Diese Vorschrift regelt, dass eine Person schuldunfähig ist, wenn sie zur Zeit der Tat aufgrund einer krankhaften seelischen Störung oder tiefgreifenden Bewusstseinsstörung nicht in der Lage war, das Unrecht ihrer Handlung einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Schuldunfähigkeit schließt eine strafrechtliche Verantwortlichkeit aus. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht stellte fest, dass die Frau aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung (§ 20 StGB) schuldunfähig war, weshalb trotz erwiesener Tat kein Strafverfahren gegen sie stattfand.
- § 315b StGB – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Diese Norm ahndet Handlungen, die den Straßenverkehr gefährden, etwa durch Behinderung oder Gefährdung von Fahrzeugen; eine solche Tat kann erheblichen Schaden und Verletzungen verursachen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Frau wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt, da ihr Verhalten auf der Autobahn kausal zu Unfällen und Schadensfolgen führte.
- § 63 StGB – Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus: Diese Maßregel dient der Besserung und Sicherung, indem psychisch kranke Straftäter untergebracht werden, wenn von ihnen eine konkrete Gefahr weiterer erheblicher rechtswidriger Taten ausgeht. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht verzichtete auf eine Unterbringung, da die Frau nach erfolgreicher Behandlung keine gegenwärtige Gefährlichkeit mehr darstellte.
- § 69 StGB – Entziehung der Fahrerlaubnis bei Ungeeignetheit: Diese Vorschrift erlaubt die Entziehung der Fahrerlaubnis, wenn ein Täter sich durch eine Straftat als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen hat, insbesondere wenn eine Gefährdung des Straßenverkehrs zu befürchten ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Behörde entband von einer dauerhaften Entziehung, weil die Frau nach Behandlung wieder als geeignet zum Führen von Fahrzeugen galt und die Tat nicht unmittelbar mit dem Fahrzeug geführt wurde.
- § 6 Abs. 1 Nr. 2 StrEG (Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen): Diese Regelung schließt den Entschädigungsanspruch aus, wenn ein Beschuldigter nur deshalb nicht verurteilt wird, weil er schuldunfähig war, somit keine strafrechtliche Verantwortlichkeit trägt. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Frau erhielt keine Entschädigung für den vorläufigen Führerscheinentzug, da ihr Freispruch auf Schuldunfähigkeit beruhte.
- § 467 StPO (Strafprozessordnung) – Kostenentscheidung bei Freispruch: Hiernach trägt bei Freispruch die Staatskasse sämtliche Verfahrenskosten und notwendigen Auslagen der freigesprochenen Person. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Prozesskosten wurden der öffentlichen Hand auferlegt, da die Frau aus rechtlichen Gründen freigesprochen wurde.
Das vorliegende Urteil
AG Olpe – Az.: 50 Ls-67 Js 938/20-21/21 – Urteil vom 29.03.2022
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.