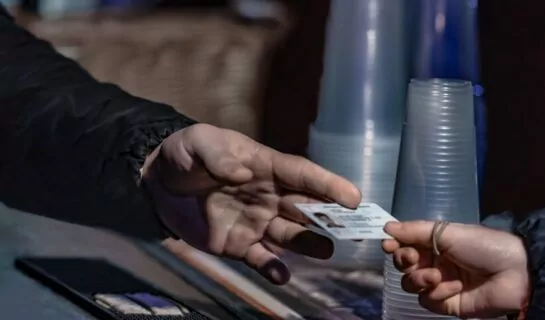Moralisches Dilemma: Tötung auf Verlangen und strafrechtliche Folgen
Das Urteil des AG Köln im Fall 613 Ls 19/15 vom 27.02.2015 bezieht sich auf eine Tötung auf Verlangen, bei der der Angeklagte für schuldig befunden wurde. Trotz der Schuldzuweisung wird von einer Strafe abgesehen, aufgrund der schweren psychischen Belastung des Täters und der besonderen Umstände des Falles. Der Täter trägt die Kosten des Verfahrens, obwohl er vom Gericht eine gewisse Form der Empathie erfährt.
Weiter zum vorliegenden Urteil Az.: 613 Ls 19/15 >>>
✔ Das Wichtigste in Kürze
Die zentralen Punkte aus dem Urteil:
- Schuldzuweisung: Der Angeklagte ist für die Tötung auf Verlangen seines Vaters schuldig.
- Strafverzicht: Trotz der Schuldzuweisung sieht das Gericht von einer Bestrafung ab.
- Psychische Belastung: Der Angeklagte erlebte unerträglichen psychischen Druck und war emotional tief mit dem Opfer verbunden.
- Familiäres Versprechen: Die Tat erfolgte aufgrund eines Versprechens, den Vater nicht leiden zu lassen.
- Seltene Krankheit: Der Vater litt an einer Krankheit, die zur vollständigen Paralyse führte.
- Eigenständiger Entschluss zur Tat: Der Täter entschied sich nach wiederholtem Flehen des Vaters zur Tat.
- Folgen für den Täter: Der Angeklagte wird lebenslang mit den Folgen der Tat konfrontiert sein.
- Kostenübernahme: Der Täter ist verantwortlich für die Kosten des Verfahrens und eigene Auslagen.
Übersicht
- Moralisches Dilemma: Tötung auf Verlangen und strafrechtliche Folgen
- ✔ Das Wichtigste in Kürze
- ✔ Wichtige Fragen und Zusammenhänge kurz erklärt
- Was umfasst der Straftatbestand der Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB und wie unterscheidet er sich von anderen Tötungsdelikten?
- Unter welchen Voraussetzungen kann gemäß § 60 StGB von einer Strafe abgesehen werden, insbesondere im Kontext schwerer Betroffenheit des Täters?
- Inwiefern beeinflusst das familiäre Umfeld und die Beziehung zwischen Täter und Opfer die rechtliche Bewertung einer Tötung auf Verlangen?
- Welche Rolle spielt der psychische Druck des Täters bei der Beurteilung der Strafbarkeit und Strafzumessung in Fällen der Tötung auf Verlangen?
- Das vorliegende Urteil
Tötung auf Verlangen – Ein moralisch und rechtlich komplexer Fall

Das Amtsgericht Köln hatte sich mit einem außergewöhnlichen und emotional aufgeladenen Fall zu befassen, der die juristischen und moralischen Grenzen des Strafrechts berührt. Der Angeklagte, ein Familienvater und beruflich Gas-/Wasserinstallateur sowie Landwirt, stand wegen Tötung auf Verlangen seines eigenen Vaters vor Gericht. Dieser Fall, unter dem Aktenzeichen 613 Ls 19/15, verhandelt am 27.02.2015, wirft ein Schlaglicht auf die komplexe Interaktion zwischen menschlichen Beziehungen, ethischen Dilemmata und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Familiäre Bindungen und ein schwieriges Versprechen
Im Zentrum dieses Falls standen die tiefe Verbundenheit zwischen dem Angeklagten und seinem Vater sowie ein Versprechen, das in einem Moment familiärer Nähe gegeben wurde. Der Vater, der an einer seltenen Krankheit litt, die zur vollständigen Paralyse und unausweichlichem Leiden führte, hatte seinen Sohn gebeten, ihn niemals in einem Zustand des Siechtums zu belassen. Diese Bitte und das damit verbundene Versprechen stellten den Angeklagten vor eine nahezu unerträgliche psychische Belastung, als sich der Gesundheitszustand des Vaters verschlechterte. Der Fall offenbart die Zerrissenheit des Angeklagten zwischen seiner moralischen Überzeugung, seinem familiären Umfeld und der Verpflichtung, einem nahestehenden Menschen Leid zu ersparen.
Der tragische Höhepunkt einer Familientragödie
Die emotionale Tragödie erreichte ihren Höhepunkt, als der Angeklagte, nachdem er mit Freunden ein Fußballspiel angesehen und Alkohol konsumiert hatte, beschloss, seinem Vater einen letzten Besuch abzustatten. Konfrontiert mit dem erneuten Flehen des Vaters, ihn von seinem Leiden zu erlösen, fühlte sich der Angeklagte schließlich gezwungen, das gegebene Versprechen einzulösen. Er erstickte seinen Vater zunächst mit einem Kissen und führte die Tat mit einem Küchenmesser zu Ende, als er vermutete, sein Vater könnte noch leben. Diese Handlungen, getrieben von psychischem Druck und einer verzweifelten emotionalen Situation, bildeten den Kern der rechtlichen Auseinandersetzung.
Das Urteil des AG Köln: Ein ungewöhnlicher Strafverzicht
Das AG Köln erkannte den Angeklagten zwar der Tötung auf Verlangen für schuldig, entschied jedoch, von einer Strafe abzusehen. Diese Entscheidung, basierend auf den §§ 216 und 60 StGB, reflektiert die außerordentliche schwere Betroffenheit des Täters. Das Gericht erachtete die Folgen der Tat, die den Angeklagten getroffen hatten, als so gravierend, dass eine zusätzliche Bestrafung als unangemessen und sinnlos angesehen wurde. Der Angeklagte wurde somit zwar für schuldig befunden, aber aufgrund der besonderen Umstände des Falles von einer Freiheitsstrafe verschont. Dennoch muss er die Kosten des Verfahrens und seine eigenen notwendigen Auslagen tragen, was die rechtliche und moralische Komplexität dieses Falles unterstreicht.
Der Fall 613 Ls 19/15 des AG Köln ist somit ein exemplarisches Beispiel dafür, wie das deutsche Rechtssystem mit Situationen umgeht, die tief in die menschliche Psyche und familiäre Bande eingreifen. Es zeigt auf, dass das Strafrecht manchmal über den Buchstaben des Gesetzes hinausgehen muss, um Gerechtigkeit in einem breiteren, menschlicheren Kontext zu erreichen.
✔ Wichtige Fragen und Zusammenhänge kurz erklärt
Was umfasst der Straftatbestand der Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB und wie unterscheidet er sich von anderen Tötungsdelikten?
Der Straftatbestand der „Tötung auf Verlangen“ nach § 216 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) ist eine spezielle Form des Tötungsdelikts, bei der der Täter einen anderen Menschen tötet, weil dieser ausdrücklich und ernsthaft darum gebeten hat. Das Verlangen des Getöteten muss dabei den Täter zur Tötung bestimmt haben, was bedeutet, dass der Täter ohne dieses Verlangen die Tat nicht begangen hätte. Die Strafandrohung liegt bei einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, und auch der Versuch ist strafbar.
Die Unterscheidung zu anderen Tötungsdelikten wie Mord (§ 211 StGB) und Totschlag (§ 212 StGB) liegt vor allem in der Motivation und den Umständen der Tat. Mord ist durch bestimmte Mordmerkmale gekennzeichnet, wie beispielsweise Habgier oder Heimtücke, und wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet. Totschlag hingegen ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen ohne Mordmerkmale und kann mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren bestraft werden.
Die „Tötung auf Verlangen“ wird als Privilegierung gegenüber dem Totschlag angesehen, da sie unter bestimmten Voraussetzungen eine mildere Strafe vorsieht. Dieser Straftatbestand trägt dem Umstand Rechnung, dass das Opfer selbst den Wunsch nach Beendigung seines Lebens geäußert hat und der Täter diesem Wunsch nachkommt. Die Privilegierung entfaltet eine Sperrwirkung, was bedeutet, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 216 StGB keine Bestrafung wegen eines anderen Tötungsdeliktes erfolgen kann.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Tötung auf Verlangen nicht anwendbar ist, wenn trotz des Tötungsverlangens ein Mordmerkmal verwirklicht ist. In solchen Fällen kann eine Verurteilung wegen Mordes in Tateinheit mit Tötung auf Verlangen erfolgen. Des Weiteren ist die Abgrenzung zur Beihilfe zum Suizid, die in Deutschland straflos ist, oft schwierig und rechtlich umstritten.
Unter welchen Voraussetzungen kann gemäß § 60 StGB von einer Strafe abgesehen werden, insbesondere im Kontext schwerer Betroffenheit des Täters?
Gemäß § 60 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) kann ein Gericht von einer Strafe absehen, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Täter bei der Tat selbst schwer verletzt wird oder durch die Tat eine ihm nahestehende Person verliert.
Die Anwendung des § 60 StGB ist jedoch auf Fälle beschränkt, in denen der Täter für die Tat keine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hat. Das bedeutet, dass bei schwereren Delikten, für die höhere Strafen vorgesehen sind, ein Absehen von Strafe nach dieser Vorschrift nicht möglich ist.
Die Norm hat Ausnahmecharakter und wird in der Rechtsprechung restriktiv gehandhabt. Bei der Entscheidung, ob von einer Strafe abgesehen wird, müssen sämtliche strafzumessungsrelevanten Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Das Gericht hat dabei ein Ermessen, ob es von einer Strafe absehen möchte, wenn die Voraussetzungen des § 60 StGB vorliegen.
In der Praxis kann das Absehen von Strafe beispielsweise dann relevant werden, wenn der Beschuldigte nach einem Unfall nach einer Trunkenheitsfahrt den Führerschein und die Fahrerlaubnis verliert und eventuell noch die Arbeit, und somit bereits „ausreichend bestraft“ ist.
Es gibt auch spezielle Regelungen für das Absehen von einer Bestrafung bei bestimmten Delikten, wie zum Beispiel im Betäubungsmittelgesetz (BtMG), wo unter bestimmten Umständen von einer Bestrafung abgesehen werden kann, wenn der Täter maßgeblich zur Aufklärung der Tat beiträgt.
Inwiefern beeinflusst das familiäre Umfeld und die Beziehung zwischen Täter und Opfer die rechtliche Bewertung einer Tötung auf Verlangen?
Das familiäre Umfeld und die Beziehung zwischen Täter und Opfer können die rechtliche Bewertung einer Tötung auf Verlangen in mehrfacher Hinsicht beeinflussen.
Zunächst ist zu beachten, dass die Beziehung zwischen Täter und Opfer eine Rolle bei der Beurteilung der Tat und der Motivation des Täters spielt. So kann beispielsweise eine enge familiäre oder partnerschaftliche Beziehung zwischen Täter und Opfer darauf hindeuten, dass der Täter aus Mitgefühl und auf ausdrücklichen Wunsch des Opfers gehandelt hat, was für eine Strafmilderung sprechen könnte.
Darüber hinaus kann die Beziehung zwischen Täter und Opfer auch Auswirkungen auf die Beweislage haben. So kann es in engen familiären oder partnerschaftlichen Beziehungen schwieriger sein, objektive Beweise für das tatsächliche Verlangen des Opfers nach der Tötung zu erbringen, da solche Gespräche oft im privaten Rahmen und ohne Zeugen stattfinden.
Schließlich kann die Beziehung zwischen Täter und Opfer auch Auswirkungen auf die moralische Bewertung der Tat durch das Gericht und die Öffentlichkeit haben. So kann eine Tötung auf Verlangen in einer engen familiären oder partnerschaftlichen Beziehung unter Umständen als weniger verwerflich angesehen werden als eine solche Tat in einer weniger engen Beziehung.
Es ist jedoch zu betonen, dass die rechtliche Bewertung einer Tötung auf Verlangen immer von den genauen Umständen des Einzelfalls abhängt und eine genaue juristische Prüfung erfordert. Es ist daher ratsam, in solchen Fällen rechtlichen Rat einzuholen.
Welche Rolle spielt der psychische Druck des Täters bei der Beurteilung der Strafbarkeit und Strafzumessung in Fällen der Tötung auf Verlangen?
Der psychische Druck des Täters spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Strafbarkeit und Strafzumessung in Fällen der Tötung auf Verlangen. Gemäß § 216 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) ist die Tötung auf Verlangen strafbar, wenn der Täter durch das ausdrückliche und ernsthafte Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt wurde.
Das Verlangen des Getöteten muss das bestimmende Motiv des Täters sein, auch wenn es nicht das einzige Motiv sein muss. Ein Täter, der bereits zur Tötung entschlossen war, kann durch ein dann geäußertes ernstliches Verlangen jedoch nicht mehr zur Tötung bestimmt werden.
Die Ernstlichkeit des Verlangens der Tötung im Sinne des § 216 StGB fehlt bei einer psychischen Störung, die einer vernünftigen Abwägung entgegensteht. Dies bedeutet, dass der psychische Druck des Täters, der durch eine psychische Störung verursacht wird, die Strafbarkeit beeinflussen kann.
Darüber hinaus kann der psychische Zustand des Täters auch die Strafzumessung beeinflussen. Wenn ein Täter als vermindert schuldfähig gilt, kann die Strafe gemäß § 21 StGB abgemildert werden.
Es ist auch wichtig, unzulässige Beeinflussungen der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung des Einzelnen, das eigene Leben zu beenden, zu vermeiden. Diese Entscheidung ist besonders schutzwürdig und es ist daher als schwerwiegendes Fehlverhalten einzuschätzen, eine Person in ihrem Sterbewunsch unzulässig zu beeinflussen.
Insgesamt hängt die Beurteilung der Strafbarkeit und Strafzumessung in Fällen der Tötung auf Verlangen stark vom psychischen Zustand und Druck des Täters ab, sowie von der Ernsthaftigkeit und Freiwilligkeit des Verlangens des Getöteten.
Das vorliegende Urteil
AG Köln – Az.: 613 Ls 19/15 – Urteil vom 27.02.2015
Der Angeklagte ist einer Tötung auf Verlangen schuldig.
Von Strafe wird abgesehen.
Er trägt die Kosten des Verfahrens sowie seine eigenen notwendigen Auslagen.
§§ 216, 60 StGB
Gründe
I.
Der Angeklagte ist in Bensberg geboren und lebt seither stets im Kölner Umfeld. Er ist verheiratet und hat eine Tochter im Alter von 17 Jahren.
Neben seinem erlernten Beruf als Gas- / Wasserinstallateur arbeitet er in der elterlichen Landwirtschaft mit.
Insgesamt erwirtschaftet er so ein monatliches Einkommen von EUR 2.000 bis 2.500.
Strafrechtlich ist der Angeklagte noch nicht aufgefallen.
II.
Aufgrund des glaubhaften Geständnisses des Angeklagten in der Hauptverhandlung steht zur Überzeugung des Gerichts folgender Sachverhalt fest:
Der Angeklagte lebt seit seiner Kindheit eng verbunden mit seinen Eltern, in deren landwirtschaftlichen Betrieb er entsprechend neben seinem eigentlichen Beruf eingebunden war.
Aufgrund eines Krankheitsfalles im familiären Umfeld gaben sich Vater und Sohn vor geraumer Zeit das Versprechen, den jeweils anderen niemals in Siechtum verfallen zu lassen.
In der jüngeren Vergangenheit erkrankte dann der Vater des Angeklagten an einer seltenen Krankheit, die schleichend zur vollständigen Paralyse der Körperfunktionen führt.
Schließlich war der Vater derart bettlägerig, das er nicht mehr in der Lage war, selbst einfachste Verrichtungen selbst vorzunehmen. Seine Paralyse war bereits derart fortgeschritten, dass innerhalb von Wochen damit gerechnet werden musste, dass auch die Atemfunktionen gelähmt werden würden.
In diesem Stadium seiner Krankheit bat der Vater den Angeklagten mehrfach, sich auf das gegebene Versprechen zu besinnen und ihn zu erlösen.
Dieser Bitte kam der Angeklagte zunächst nicht nach, weil er den Mut dazu nicht aufbrachte.
Am 28.06.2014 besuchte der Angeklagte dann mit Freunden ein Lokal, um sich ein Fußball-Länderspiel anzusehen.
Dabei trank er auch einige Gläser Bier.
Nach dem Spiel verließ er das Lokal und beschloss, noch kurz nach seinem Vater zu sehen.
Erneut forderte letzterer den Angeklagten auf, ihn von seinem Leid zu erlösen. Der Angeklagte nahm daraufhin ein Kissen und drückte es seinem Vater in der Absicht, ihn zu töten, auf das Gesicht. Dabei küsste er ihn auf die Stirn und nahm innerlich Abschied.
Als der Vater sich schließlich nicht mehr regte, ging der Angeklagte zunächst davon aus, mit seinem Vorhaben erfolgreich gewesen zu sein.
Nachdem der Angeklagte sich vom Bett kurz abgewandt hatte vernahm er jedoch ein Geräusch und verfiel anschließend in Panik. Er befürchtete, der Vater lebe möglicherweise noch und er – der Angeklagte – habe nun durch den Erstickungsversuch das Leid des Vaters nochmals erhöht.
Aus diesem Grund nahm er ein Küchenmesser und stach es dreimal in den Hals des Vaters, der schließlich durch Verbluten verstarb.
III.
Der Angeklagte ist damit einer Tötung auf Verlangen schuldig, § 216 StGB.
IV.
Bei der Strafzumessung ist das Gericht von folgenden Überlegungen ausgegangen:
Der Strafrahmen für die Tötung auf Verlangen ergibt sich.aus § 216 StGB mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren.
Gemäß § 60 StGB kann allerdings von Strafe abgesehen werden, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre.
Der Angeklagte stand zur Tatzeit unter nahezu unerträglichem psychischem Druck. Er hat seinem Vater stets nahe gestanden und pflegte ein inniges Verhältnis. Nachdem beide Männer erleben mussten, wie eine ihnen nahe stehende Person nach einer Erkrankung in Siechtum verfiel, nahmen sie sich gegenseitig das ernst gemeinte Versprechen ab, so etwas für den jeweils anderen niemals zuzulassen.
Als der Vater des Angeklagten schließlich entsprechend erkrankte, geriet der Angeklagte mehr und mehr unter Druck.
Er fühlte sich an sein Versprechen gebunden und wurde vom Vater vielfach angefleht, ihn von seinem Leid zu erlösen. Zunächst widerstand der Angeklagte diesem Ansinnen, konnte sich aber letztlich dem immer wieder geäußerten Wunsch des Vaters nicht mehr entziehen.
Er hat mit der Tat einen ihm wertvollen und sehr nahe stehenden Menschen verloren und die Tat nur aus Respekt vor dessen Flehen begangen.
Nach eigenen Angaben sieht er die Bilder dieses Abends jeden Tag vor sich und wird mit ihnen ein Leben lang zurechtkommen müssen.
Mit seinem Verhalten setzt sich der Angeklagte fortlaufend aufeinander und erwägt auch, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, sollte er das Geschehen nicht alleine bewältigen können. Dabei wird er von seiner gesamten Familie einschließlich seiner Mutter vorbehaltlos unterstützt, die ihn für seine Tat in keiner Form verurteilt.
Vor diesem Hintergrund dürfte der Angeklagte selbst so unmittelbar und schwer von den Folgen seines Verhaltens betroffen sein, dass jede weitere Strafe daneben verfehlt erscheint und sinnlos sein dürfte.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 465 Abs. 1 StPO.