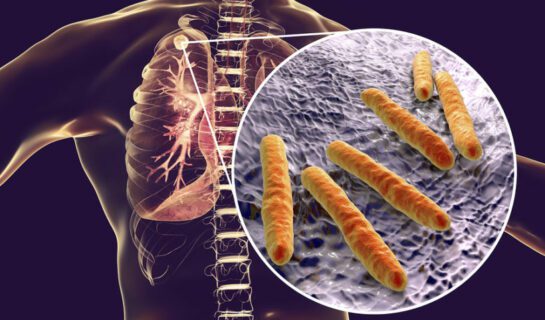Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Wohnungsdurchsuchung: Grundrechte und Anfangsverdacht im Fokus eines Falls
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Ab wann ist eine Wohnungsdurchsuchung rechtlich zulässig?
- Welche Rechte habe ich während einer Wohnungsdurchsuchung?
- Was passiert mit beschlagnahmten Gegenständen bei einer rechtswidrigen Durchsuchung?
- Wie kann ich gegen eine Durchsuchung rechtlich vorgehen?
- Welche Entschädigungsansprüche bestehen bei einer rechtswidrigen Durchsuchung?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Bremen
- Datum: 29.02.2024
- Aktenzeichen: 8 Qs 49/24
- Verfahrensart: Beschwerdeverfahren gegen eine Durchsuchungsanordnung
- Rechtsbereiche: Strafprozessrecht Beteiligte Parteien: – Beschuldigter: Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Durchsuchungsanordnung. Er argumentiert, dass die Durchsuchung seiner Wohnung, Nebenräume, Fahrzeuge und persönlichen Gegenstände keine ausreichende Rechtsgrundlage hatte und somit rechtswidrig war. – Staatsanwaltschaft: Hat die Durchsuchung beantragt im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den Beschwerdeführer. – Zeugin (Ex-Partnerin des Beschuldigten): Erklärte, sie habe 2008 kinderpornografische Inhalte auf einem gemeinsamen Rechner gesehen und machte Aussagen über Vermutungen ihres Sohnes, der sich psychisch instabil fühlte und angab, möglicherweise vom Beschuldigten missbraucht worden zu sein.
Um was ging es?
- Sachverhalt: Im Rahmen eines im Februar 2023 eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern zwischen 2000 und 2003 gegen den Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung seiner Wohnung, Nebenräume, Fahrzeuge und persönlichen Gegenstände angeordnet. Diese Maßnahme stützte sich auf die Aussagen der Ex-Partnerin des Beschuldigten, die angab, im Jahr 2008 kinderpornografische Inhalte gesehen zu haben, sowie auf die vagen Vermutungen ihres Sohnes.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging um die Frage, ob die Durchsuchungsanordnung rechtmäßig war, insbesondere ob die Angaben der Zeugin und die Vermutungen ihres Sohnes als ausreichende Grundlage für einen solchen Eingriff in die Grundrechte des Beschuldigten ausreichten.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Landgericht Bremen hob den Beschluss des Amtsgerichts Bremen vom 05.06.2023 auf und stellte fest, dass die Durchsuchung rechtswidrig war.
- Begründung: Das Gericht stellte fest, dass die Durchsuchungsanordnung nicht ausreichend begründet war. Weder die Aussagen der Zeugin über Inhalte von 2008 noch die vagen Vermutungen ihres Sohnes lieferten einen hinreichenden Anfangsverdacht, der eine Durchsuchung rechtfertigen könnte.
- Folgen: Die Staatskasse trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die notwendigen Auslagen des Beschuldigten. Der Beschuldigte ist nicht mehr von den Rechtsfolgen der Durchsuchung betroffen. Das Urteil verdeutlicht, dass für Eingriffe in Grundrechte ein klarer und fundierter Verdacht erforderlich ist.
Wohnungsdurchsuchung: Grundrechte und Anfangsverdacht im Fokus eines Falls
Eine Wohnungsdurchsuchung stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte dar und darf nur unter strengen Voraussetzungen erfolgen. Für die Anordnung einer Durchsuchung durch die Ermittlungsbehörden muss ein konkreter Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegen. Das bedeutet, es müssen tatsächliche Anhaltspunkte existieren, die nach kriminalistischer Erfahrung auf eine verfolgbare Straftat hindeuten.
Bei strafrechtlichen Ermittlungen spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle, denn Straftaten können verjähren. Ein Durchsuchungsbeschluss kann nur dann rechtmäßig sein, wenn die vermutete Straftat zum Zeitpunkt der Beweiserhebung noch nicht verjährt ist. Betroffene können sich in solchen Fällen an einen Anwalt für Strafrecht wenden und Rechtsmittel einlegen. Wie ein aktueller Fall aus Bremen zeigt, prüfen Gerichte die Rechtmäßigkeit solcher Maßnahmen sehr genau.
Der Fall vor Gericht
Gericht prüft Rechtmäßigkeit von Durchsuchung wegen Kinderpornografie-Verdacht

Das Landgericht Bremen hat in einem Beschluss vom 29. Februar 2024 eine Wohnungsdurchsuchung für rechtswidrig erklärt. Die Durchsuchung war im Juni 2023 aufgrund des Verdachts des Besitzes kinderpornografischer Inhalte erfolgt. Das Gericht stellte fest, dass die materiellen Voraussetzungen für die Durchsuchungsanordnung nicht vorlagen.
Fragwürdige Verdachtsgrundlage aus dem Jahr 2008
Der Fall nahm seinen Anfang durch die Aussage einer Zeugin, die angab, im Jahr 2008 auf einem gemeinsam genutzten Computer „zwei bis drei Videos“ mit pornografischen Inhalten gesehen zu haben, an denen nach ihrer Einschätzung zehn- bis zwölfjährige Mädchen beteiligt gewesen seien. Die Zeugin konnte ihre Alterseinschätzung jedoch nicht näher begründen. Das Gericht wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Einschätzung des Alters von Kindern und Jugendlichen generell fehleranfällig sei.
Keine ausreichenden Anhaltspunkte für aktuellen Besitz
Das Gericht kritisierte, dass keine zureichenden Anhaltspunkte vorlagen, die einen aktuellen Besitz kinderpornografischer Inhalte vermuten ließen. Die Annahme des Amtsgerichts, der Beschuldigte müsse aufgrund einer pädophilen Neigung auch Jahre später noch im Besitz solchen Materials sein, wurde als nicht tragfähig eingestuft. Eine solche Verdachtsannahme würde nach Ansicht des Gerichts zu einer unzulässigen Entgrenzung der Strafverfolgung führen.
Schwerwiegender Grundrechtseingriff ohne ausreichende Grundlage
Die Durchsuchung verletzte nach Feststellung des Gerichts das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Die bei der Durchsuchung sichergestellten 26 Datenträger dürfen nicht weiter ausgewertet werden, da dies das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen verletzen würde. Das Gericht betonte, dass ein möglicher früherer Besitz kinderpornografischer Inhalte im Jahr 2008 ohnehin bereits verjährt sei. Die Kosten des Verfahrens muss die Staatskasse tragen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Gericht stellt klar, dass für eine Wohnungsdurchsuchung ein konkreter Anfangsverdacht vorliegen muss, der sich auf aktuelle Beweise stützt. Die bloße Vermutung einer fortbestehenden Neigung oder Jahre zurückliegende Beobachtungen reichen nicht aus. Besonders wichtig ist die präzise und korrekte Wiedergabe von Zeugenaussagen in Durchsuchungsbeschlüssen. Das Urteil stärkt den Schutz der Privatsphäre vor unverhältnismäßigen staatlichen Eingriffen.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben Sie das Recht, die Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen – auch nachträglich. Die Behörden müssen konkrete und aktuelle Verdachtsmomente vorweisen, alte Vorwürfe oder Vermutungen reichen nicht aus. Wird eine Durchsuchung für rechtswidrig erklärt, trägt der Staat die Verfahrenskosten. Sie können sich gegen ungerechtfertigte Durchsuchungen wehren, auch wenn diese bereits stattgefunden haben. Lassen Sie sich im Zweifelsfall anwaltlich beraten, um Ihre Rechte zu wahren.
Benötigen Sie Hilfe?
Unrechtmäßige Wohnungsdurchsuchung?
Eine Wohnungsdurchsuchung ist ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre. Das Gericht hat klargestellt, dass vage Vermutungen oder Jahre zurückliegende Beobachtungen für eine solche Maßnahme nicht ausreichen. Es braucht konkrete, aktuelle Hinweise.
Wurde Ihre Wohnung durchsucht, obwohl Sie sich ungerecht behandelt fühlen, kann es sich lohnen, die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung überprüfen zu lassen. Unsere Kanzlei unterstützt Sie dabei, Ihre Rechte zu verstehen und sich gegen unverhältnismäßige staatliche Eingriffe zu wehren.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Situation zu besprechen. Wir prüfen die Details Ihres Falls und helfen Ihnen, die nächsten Schritte zu gehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ab wann ist eine Wohnungsdurchsuchung rechtlich zulässig?
Eine Wohnungsdurchsuchung ist nur unter streng definierten rechtlichen Voraussetzungen zulässig, da sie einen erheblichen Eingriff in das durch Artikel 13 Grundgesetz geschützte Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung darstellt.
Grundlegende Voraussetzungen
Ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss ist die wichtigste Voraussetzung für eine legale Wohnungsdurchsuchung. Nur in Ausnahmefällen, bei Gefahr im Verzug, dürfen Staatsanwaltschaft oder Polizei eine Durchsuchung ohne richterlichen Beschluss anordnen.
Inhaltliche Anforderungen
Der Durchsuchungsbeschluss muss folgende konkrete Angaben enthalten:
- Bezeichnung der zur Last gelegten Straftat
- Inhalt des Strafvorwurfs
- Beschreibung von Ziel, Ausmaß und Zweck der Durchsuchung
- Konkrete Bezeichnung der gesuchten Beweismittel und der zu durchsuchenden Räume
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme
Die Durchsuchung muss verhältnismäßig sein. Dies bedeutet, sie muss in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts stehen. Wenn andere, weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen, ist eine Durchsuchung nicht zulässig.
Zeitliche Beschränkung
Ein Durchsuchungsbeschluss verliert nach sechs Monaten seine Gültigkeit. Nach Ablauf dieser Frist muss ein neuer Beschluss erwirkt werden, wenn die Durchsuchung noch durchgeführt werden soll.
Bei einer anonymen Anzeige ist eine Durchsuchung nur zulässig, wenn die Anzeige von beträchtlicher sachlicher Qualität ist oder mit ihr zusammen schlüssiges Tatsachenmaterial vorgelegt wurde.
Welche Rechte habe ich während einer Wohnungsdurchsuchung?
Recht auf Prüfung des Durchsuchungsbeschlusses
Sie haben das Recht, sich zu Beginn der Durchsuchung den richterlichen Durchsuchungsbeschluss zeigen zu lassen. Dieser muss folgende Angaben enthalten:
- Die konkrete Straftat, die Ihnen zur Last gelegt wird
- Den genauen Inhalt des Strafvorwurfs
- Das Ziel und den Zweck der Durchsuchung
- Eine präzise Beschreibung der zu durchsuchenden Räume
Anwesenheitsrecht und Zeugenbeiziehung
Sie haben das Recht auf Anwesenheit während der gesamten Durchsuchung, sind aber nicht dazu verpflichtet. Wenn Sie nicht anwesend sein können oder wollen, darf ein Vertreter, ein erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar als Zeuge hinzugezogen werden.
Keine aktive Mitwirkungspflicht
Während der Durchsuchung besteht lediglich eine Duldungspflicht. Das bedeutet:
- Sie müssen die Durchsuchung zwar grundsätzlich zulassen
- Sie müssen jedoch keine aktive Mithilfe leisten
- Sie sind nicht verpflichtet, Schränke zu öffnen oder Passwörter für Computer herauszugeben
Zeitliche Beschränkungen
Die Durchsuchung darf nicht zwischen 21 Uhr und 4 Uhr im Sommer bzw. 21 Uhr und 6 Uhr im Winter durchgeführt werden, außer es liegt ein besonderer Ausnahmefall vor.
Dokumentationsrechte
Sie haben das Recht auf:
- Ein Durchsuchungsprotokoll, in dem alle beschlagnahmten Gegenstände aufgelistet sind
- Die Dokumentation Ihres Widerspruchs gegen die Durchsuchung oder einzelne Maßnahmen
Schutz der Privatsphäre
Die Durchsuchung darf nur in den im Beschluss genannten Räumlichkeiten erfolgen. Die Ermittler dürfen ausschließlich nach Gegenständen suchen, die im Zusammenhang mit dem vorgeworfenen Delikt stehen.
Was passiert mit beschlagnahmten Gegenständen bei einer rechtswidrigen Durchsuchung?
Eine rechtswidrige Durchsuchung führt nicht automatisch dazu, dass beschlagnahmte Gegenstände zurückgegeben werden müssen oder nicht als Beweismittel verwendet werden dürfen. Die rechtliche Bewertung erfolgt in zwei getrennten Schritten:
Bewertung der Durchsuchung
Die Rechtswidrigkeit einer Durchsuchung kann verschiedene Gründe haben:
Formale Mängel können vorliegen bei:
- Fehlender richterlicher Anordnung ohne Gefahr im Verzug
- Unzureichender Begründung des Durchsuchungsbeschlusses
- Überschreitung der 6-Monatsfrist des Durchsuchungsbeschlusses
Folgen für beschlagnahmte Gegenstände
Die Verwertbarkeit beschlagnahmter Gegenstände wird nach der Abwägungstheorie beurteilt. Dabei werden folgende Aspekte gegeneinander abgewogen:
Für ein Verwertungsverbot sprechen:
- Vorsätzlicher Missbrauch durch Ermittlungsbehörden
- Schwere der Rechtsverletzung
- Verletzung grundlegender Verfahrensrechte
Gegen ein Verwertungsverbot sprechen:
- Nur leichte Verfahrensverstöße
- Möglichkeit der rechtmäßigen Beweiserlangung auf anderem Weg
- Schwere der aufzuklärenden Straftat
Rechtliche Möglichkeiten für Betroffene
Bei einer rechtswidrigen Durchsuchung können Sie:
Beschwerde gegen die Beschlagnahme einlegen und die Herausgabe der Gegenstände beantragen. Die Beschlagnahme wird aufgehoben, wenn die Gegenstände für das Verfahren nicht mehr benötigt werden.
Ein Beweisverwertungsverbot muss gesondert geltend gemacht werden. Die Rechtsprechung sieht ein solches Verbot nur in Ausnahmefällen vor, etwa bei besonders schweren Verstößen gegen Verfahrensvorschriften oder bei willkürlichem Handeln der Ermittlungsbehörden.
Wie kann ich gegen eine Durchsuchung rechtlich vorgehen?
Rechtsmittel gegen richterliche Durchsuchungsanordnungen
Wenn Sie von einer Durchsuchung betroffen sind, können Sie gegen den richterlichen Durchsuchungsbeschluss Beschwerde nach § 304 StPO einlegen. Diese Beschwerde ist beim Gericht einzureichen, das den Durchsuchungsbeschluss erlassen hat. Eine besondere Frist müssen Sie dabei nicht einhalten. Für diese Beschwerde entstehen keine Gerichtskosten.
Vorgehen bei Gefahr im Verzug
Bei Durchsuchungen durch Polizei oder Staatsanwaltschaft wegen Gefahr im Verzug steht Ihnen der Antrag auf richterliche Entscheidung nach § 98 Abs. 2 StPO zur Verfügung. Nach der Entscheidung des Gerichts können Sie wiederum Beschwerde einlegen.
Rechtsmittel gegen die Art der Durchführung
Wenn Sie die konkrete Durchführung der Durchsuchung beanstanden möchten, können Sie einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach §§ 23 EGGVG stellen. Dieser Antrag muss innerhalb eines Monats beim Kammergericht eingereicht werden. Hierbei können Gerichtskosten bis zu mehreren hundert Euro anfallen.
Verfassungsbeschwerde als letztes Mittel
Nach Ausschöpfung der anderen Rechtsmittel ist eine Verfassungsbeschwerde möglich. Diese müssen Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung des ablehnenden Beschlusses beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. Bei der Verfassungsbeschwerde entstehen keine Gerichtskosten.
Wichtige Hinweise zur Durchführung
Ein Durchsuchungsbeschluss ist maximal sechs Monate gültig. Die Beschwerde gegen eine Durchsuchungsanordnung kann auch dann noch eingelegt werden, wenn die Durchsuchung bereits abgeschlossen ist. In diesem Fall wird die Rechtmäßigkeit der Maßnahme im Nachhinein überprüft.
Während der laufenden Durchsuchung sollten Sie einen förmlichen Widerspruch gegen die Beschlagnahme zu Protokoll geben. Dies ist wichtig für mögliche spätere Rechtsmittel. Die Einlegung von Rechtsmitteln verhindert allerdings nicht die sofortige Durchführung der Durchsuchung oder Beschlagnahme.
Welche Entschädigungsansprüche bestehen bei einer rechtswidrigen Durchsuchung?
Bei einer rechtswidrigen Durchsuchung steht Ihnen ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) zu.
Voraussetzungen für den Entschädigungsanspruch
Ein Anspruch besteht, wenn Sie durch eine Durchsuchung einen Schaden erlitten haben und einer der folgenden Fälle vorliegt:
- Das Strafverfahren wurde eingestellt
- Sie wurden freigesprochen
- Das Gericht hat die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt
Umfang der Entschädigung
Der Entschädigungsanspruch umfasst den unmittelbaren Vermögensschaden, der durch die Durchsuchung entstanden ist. Hierzu gehören:
- Beschädigungen an der Wohnung oder dem Eigentum
- Kosten für einen Rechtsanwalt
- Verdienstausfall während der Durchsuchung
- Kosten für die Wiederherstellung beschädigter Gegenstände
Antragstellung und Fristen
Sie müssen den Entschädigungsanspruch aktiv geltend machen. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung über die Verfahrenseinstellung oder des Freispruchs zu stellen. Die Entscheidung über die Entschädigung trifft die Staatsanwaltschaft.
Besonderheiten bei psychischen Folgen
Seit 2024 können auch psychische Beeinträchtigungen durch eine rechtswidrige Durchsuchung entschädigt werden. Dies gilt insbesondere bei schwerwiegenden Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte. Die Entschädigung richtet sich nach dem Einzelfall und der Schwere der Beeinträchtigung.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Wohnungsdurchsuchung
Eine Wohnungsdurchsuchung ist eine staatliche Maßnahme, bei der Ermittlungsbehörden eine Wohnung oder einen sonstigen privaten Raum durchsuchen, um Beweise für eine Straftat zu sichern. Diese Maßnahme greift tief in das Privatleben des Betroffenen ein und berührt deshalb Grundrechte wie das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, das im Grundgesetz (Art. 13) verankert ist. Sie darf nur erfolgen, wenn es einen konkreten Anfangsverdacht gibt und ein Durchsuchungsbeschluss vorliegt, der den Eingriff rechtfertigt. Beispiel: Vor der Durchsuche einer Wohnung muss ein Richter bestätigen, dass es hinreichende Anhaltspunkte für eine Straftat gibt.
Grundrechte
Grundrechte sind die fundamentalen Rechte, die jeder Mensch in Deutschland besitzt und die im Grundgesetz (GG) verankert sind, wie etwa die Menschenwürde, die Freiheit und das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Sie schützen den Einzelnen vor unrechtmäßigen Eingriffen durch den Staat und gewährleisten eine freie Entfaltung der Persönlichkeit. Eingriffe in diese Rechte, wie etwa im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung, müssen besonders gut begründet und verhältnismäßig sein. Beispiel: Bei der Wohnungsdurchsuchung wird immer geprüft, ob der Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen gerechtfertigt ist.
Anfangsverdacht
Der Anfangsverdacht bezeichnet den ersten, konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer Straftat, basierend auf ersten Anhaltspunkten oder Zeugenaussagen. Er bildet die Grundlage für weiterführende Ermittlungen und muss hinreichend plausibel und nachvollziehbar sein, wie es in der Strafprozessordnung (StPO) erwartet wird. Dieser Verdacht reicht jedoch noch nicht aus, um von der Schuld des Beschuldigten auszugehen, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für weitere Ermittlungen und Beweiserhebungen. Beispiel: Eine Zeugenaussage, die andeutet, dass jemand ein Delikt begangen haben könnte, kann den Anfangsverdacht begründen, ohne dass der Täter bereits überführt wurde.
Durchsuchungsbeschluss
Ein Durchsuchungsbeschluss ist ein richterlicher Beschluss, der die Durchführung einer Wohnungsdurchsuchung rechtfertigt. Er stellt sicher, dass die Maßnahme rechtsstaatlichen Anforderungen entspricht, indem sie nur auf Grundlage konkreter und nachvollziehbarer Anhaltspunkte erfolgt, wie in der Strafprozessordnung (StPO) festgelegt. Der Beschluss regelt auch den Rahmen der Durchsuchung, um willkürliche Eingriffe in die Privatsphäre zu vermeiden. Beispiel: Bevor die Polizei eine Wohnung durchsucht, muss ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, der den Verdacht und den Umfang der Durchsuchung detailliert begründet.
Verjährung
Verjährung bezeichnet den Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist, nach der strafrechtliche Verfolgung eines Delikts nicht mehr zulässig ist. Diese Frist dient der Rechtsklarheit und soll verhindern, dass alte Fälle, bei denen Beweismaterial und Zeugenaussagen schwer zu sichern sind, unendlich lange verfolgt werden. Die genauen Fristen und Voraussetzungen für die Verjährung sind im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt und können je nach Schwere der Tat variieren. Beispiel: Wenn eine Straftat, wie der Besitz kinderpornografischer Inhalte, bereits vor 15 Jahren begangen wurde und die Verjährungsfrist abgelaufen ist, darf der Täter nicht mehr strafrechtlich belangt werden.
Beweiserhebung
Beweiserhebung bezeichnet den Prozess des Sammelns, Sichern und Dokumentierens von Beweisen im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen. Sie muss unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Strafprozessordnung (StPO), erfolgen, um die Rechtmäßigkeit der gewonnenen Beweise zu gewährleisten. Der Zeitpunkt und die Art der Beweiserhebung sind entscheidend, da etwaige Verzögerungen dazu führen können, dass Beweismittel später als unzulässig erklärt werden, wenn beispielsweise die Verjährung eingetreten ist. Beispiel: Die Sicherstellung digitaler Datenträger bei einer Wohnungsdurchsuchung fällt in den Bereich der Beweiserhebung, die genau reglementiert ist.
Rechtsmittel
Rechtsmittel sind förmliche Mittel, mit denen eine gerichtliche Entscheidung angefochten und von einer höheren Instanz überprüfen werden kann. Dazu zählen beispielsweise Berufung und Revision, die in der Strafprozessordnung (StPO) geregelt sind und den Betroffenen die Möglichkeit geben, Fehler in der Beweiswürdigung oder Rechtsanwendung geltend zu machen. Sie stellen ein zentrales Instrument zur Sicherstellung eines fairen Verfahrens dar und dienen dem Schutz des Einzelnen vor möglichen Justizirrtümern. Beispiel: Nach einer rechtswidrigen Wohnungsdurchsuchung kann sich der Betroffene an seinen Anwalt wenden und Rechtsmittel einlegen, um das Urteil anzufechten.
Informationelle Selbstbestimmung
Die informationelle Selbstbestimmung ist das Recht des Einzelnen, über die Preisgabe, Verwendung und Kontrolle seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Dieses Grundrecht wurde durch das Bundesverfassungsgericht aus dem Grundgesetz abgeleitet und schützt vor unkontrollierter Datenerfassung und -auswertung, etwa im Zuge behördlicher Maßnahmen. Bei Maßnahmen wie der Wohnungsdurchsuchung wird darauf geachtet, dass die Erhebung und Verarbeitung von Daten die informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen nicht unzulässig einschränkt. Beispiel: Werden bei einer Durchsuchung auf einem Computer Daten sichergestellt, muss überprüft werden, ob dies im Rahmen des Erforderlichen bleibt und die informationelle Selbstbestimmung gewahrt wird.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Art. 13 Grundgesetz (GG): Dieser Artikel schützt die Unverletzlichkeit der Wohnung und garantiert, dass Durchsuchungen nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen durchgeführt werden dürfen. Die Wohnung darf nur durch einen richterlichen Beschluss durchsucht werden, der auf einem konkreten Anfangsverdacht basiert. Im vorliegenden Fall wurde die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten als rechtswidrig bewertet, da die Voraussetzungen des Art. 13 GG nicht erfüllt waren.
- §§ 102 ff. Strafprozessordnung (StPO): Diese Paragraphen regeln die Voraussetzungen und das Verfahren für Durchsuchungen im Strafverfahren. Sie stellen sicher, dass Durchsuchungsmaßnahmen nur erfolgen, wenn ein hinreichender Anfangsverdacht besteht und die Maßnahme verhältnismäßig ist. Das Amtsgericht Bremen hatte die Durchsuchung angeordnet, jedoch stellte das Landgericht fest, dass der erforderliche Anfangsverdacht nicht ausreichend gegeben war, wodurch die Durchsuchung gemäß StPO rechtswidrig wurde.
- § 176 Strafgesetzbuch (StGB): Dieser Paragraph behandelt den sexuellen Missbrauch von Kindern und definiert die entsprechenden Straftatbestände. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten beruhten auf dem Verdacht, Kinder sexuellen Missbrauchs begangen zu haben, was den Hintergrund für die beantragte Durchsuchung bildete. Allerdings reichten die vorgelegten Beweise nicht aus, um den notwendigen Verdacht für eine rechtmäßige Durchsuchung zu untermauern.
- § 184b Strafgesetzbuch (StGB): Dieser Paragraph kriminalisiert den Besitz und die Verbreitung kinderpornographischer Inhalte. Die Staatsanwaltschaft begründete die Durchsuchung auch mit dem Verdacht, dass der Beschuldigte solche Inhalte besaß und online verbreitete. Da die Durchsuchung jedoch als rechtswidrig eingestuft wurde, konnten keine Beweise für den Besitz kinderpornographischer Materialien vorgelegt werden.
- Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz (GG): Diese Bestimmung garantiert den effektiven Rechtsschutz bei Grundrechtsverletzungen, indem sie betroffenen Personen ermöglicht, die Aufhebung oder Änderung eines rechtswidrigen Gesetzes oder Verwaltungsakts vor Gericht zu verlangen. Der Beschuldigte nutzte dieses Recht, um den ursprünglichen Durchsuchungsbeschluss anzufechten, was zur Aufhebung der Durchsuchung durch das Gericht führte.
Das vorliegende Urteil
LG Bremen – Az.: 8 Qs 49/24 – Beschluss vom 29.02.2024
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.